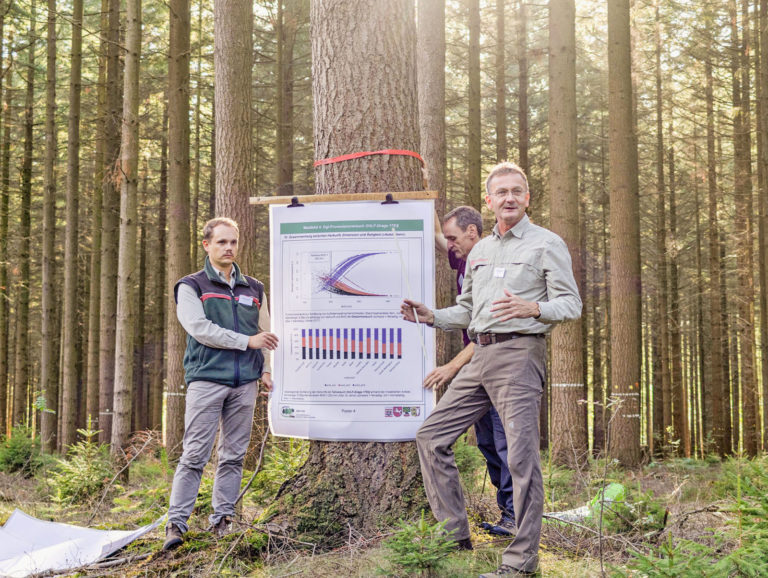Jetzt im Herbst fallen viele Pflanzenreste an, die den Rohstoff für wertvollen Kompost liefern. Damit schlägt man nicht nur gestiegenen Düngerpreisen ein Schnippchen, sondern tut gleichzeitig noch etwas Gutes für den Boden. Denn humusreicher Kompost lockert den Boden, sodass er in der Folge besser Wasser und Nährstoffe speichern kann. Zudem enthält Kompost viele Nährstoffe, die einen Großteil unserer Nutz- und Zierpflanzen ausreichend versorgen.
Grund genug also, einen Komposter entweder selbst zu bauen oder sich im Baumarkt nach einem passenden Modell umzusehen. Tipp: Manche Gemeinden oder Landkreise gewähren inzwischen Zuschüsse für die Neuanschaffung – einfach mal nachfragen. Ziel ist es, die kommunale Müllentsorgung zu entlasten, indem kompostierbare Abfälle nicht in der Grünen Tonne landen.
Aus Paletten oder anderen Holzresten kann man einen Behälter günstig zusammenbauen. Wichtig: Das Holz darf nicht mit Holzschutzmitteln behandelt sein. Mit „HT“ gekennzeichnete Paletten sind lediglich hitzebehandelt und können daher unbedenklich verwendet werden. Auch Reste von Baustahlmatten eignen sich hervorragend für die Konstruktion eines Sammelbehälters. Wer kein passendes Material zu Hause vorfindet, wird im Baumarkt bei den Fertigmodellen fündig. Lange haltbar sind Komposter aus feuerverzinktem Metall, die aus vier Seitenteilen bestehen. Bei 1 m2 Grundfläche und 80 cm Höhe fassen sie immerhin 800 l Inhalt. Sie liegen preislich je nach Anbieter bei etwa 60 bis 80 €. Praktisch ist es natürlich, je nach anfallender Pflanzenmenge gleich mehrere nebeneinander aufzustellen. Etwas günstiger sind einfache Holzkomposter. Wie so oft sind preislich nach oben keine Grenzen gesetzt. Dennoch erfüllen die günstigen oder selbst gebauten Modelle ihren Zweck genauso wie die knapp 600 € (!) teure Kompostkiste eines Versandhändlers aus Lärchenholzbrettern und stahlarmierten Betonpfosten.
Grundlegende Voraussetzung für den Kompostierungsprozess ist, dass Luft an die Abfälle kommt und Erdkontakt besteht. Die unbeschränkte Zu- und Abwanderung der Bodenlebewesen ermöglicht es ihnen, die Abfälle in Humus zu verwandeln. Küchenabfälle sollten jedoch nicht in den offenen Komposter gegeben werden, da sie Ratten und Mäuse anziehen. Selbst in geschlossenen Silos mit untergelegtem Draht können erfahrungsgemäß die Nager einwandern, indem sie einfach ein Loch in die Wand beißen. Tipp: Küchenabfälle immer über die Biotonne entsorgen.
Der optimale Platz für den Komposter liegt nicht zu sonnig, am besten im Halbschatten oder unter einem Baum. In der prallen Sonne trocknen die Abfälle aus, in tiefem Schatten kommt die Rotte wegen der niedrigeren Temperaturen nicht so recht in Gang. Gern darf es auf den Komposter regnen, denn ausreichende Feuchtigkeit ist wichtig für den Umwandlungsprozess.
Wer schon gleich beim Sammeln der Abfälle auf die richtige Mischung achtet, kann sich das Umsetzen sparen. Manche Gärtner sammeln daher zunächst getrennt trockene und feuchte Abfälle und schichten sie, sobald ausreichend Material vorhanden ist, im Behälter in 20 bis 30 cm hohen Lagen abwechselnd auf. Da das Material zusammensackt, lassen sich fortlaufend neue Schichten einfüllen. Die Dauer des Kompostierungsprozesses, also bis aus den Pflanzenabfällen reifer Kompost geworden ist, hängt vom Behälter, dem Mischungsverhältnis und der Jahreszeit ab. Als Faustregel gilt: Je kürzer die Rottezeit, desto mehr Nährstoffe enthält der Kompost. In Rohkompost befinden sich noch unvollständig verrottete Pflanzenreste. Nach dem Aussieben lässt er sich als Dünger für hungrige Starkzehrer im Gemüsegarten, das Staudenbeet oder unter Obstgehölzen verwenden. Reifer Kompost hingegen ist dunkel und weich, enthält also keine unverrotteten Bestandteile mehr. Er eignet sich als Grunddüngung im Gemüse- und Ziergarten, indem 2 bis 5 l/m² leicht in den Boden eingearbeitet werden. Reifer Kompost ergibt mit Tongranulat und Gartenerde vermischt eine kostengünstige Kübelpflanzen- und Balkonblumenerde. Tipp: Ausgesiebte Pflanzenreste einfach wieder auf den Kompost geben.
Nicht auf den Kompost gehören neben den Küchenabfällen Holzasche (wegen enthaltener Schwermetalle), Grillkohle, Kot von Fleischfressern und kompostierbare Plastikabfälle wie Mülltüten oder melaninhaltiges Einmalgeschirr aus Bambus. Sie zersetzen sich zum einen nur sehr langsam und zerfallen zum anderen zu Wasser und CO2. Somit entsteht also kein wertvoller Humus und das Plastik muss im Endeffekt doch wieder aus dem Kompost herausgesiebt werden.
Einstreu von Pflanzenfressern wie Kaninchen kann dagegen bedenkenlos kompostiert werden. Auch Sägemehl, Hobelspäne (aus unbehandeltem Holz), Schnittblumen, Baum- und Strauchschnitt, Rasenschnitt und Laub ergeben richtig aufgeschichtet wunderbare Komposterde. Fallobst oder faules Lagerobst, an Mehltau, Rost oder Schorf erkrankte Pflanzen dürfen ebenfalls auf den Kompost. An bodenbürtigen Pilzen, Bakterien oder Viren erkrankte Pflanzen entsorgt man besser über die Braune Biotonne. Gleiches gilt für von Schädlingen befallenes Gemüse oder Obst. Sie könnten die Rotte im eigenen Garten überleben, während sie im Kompostwerk durch professionelle Behandlungsverfahren abgetötet werden.