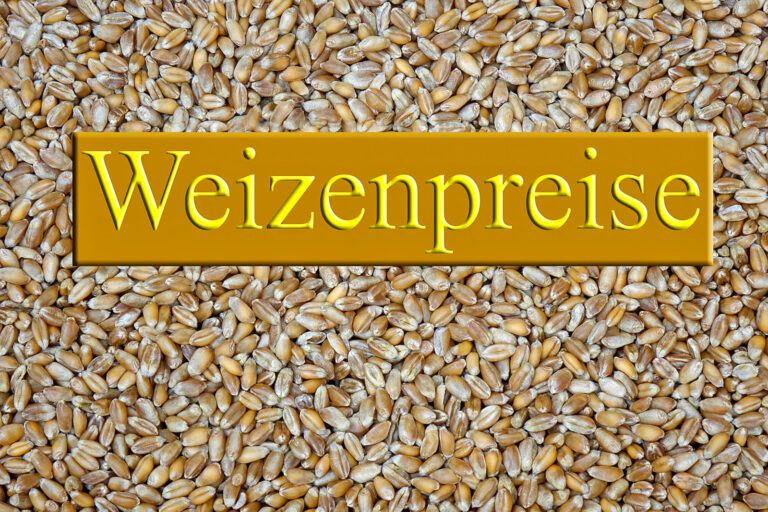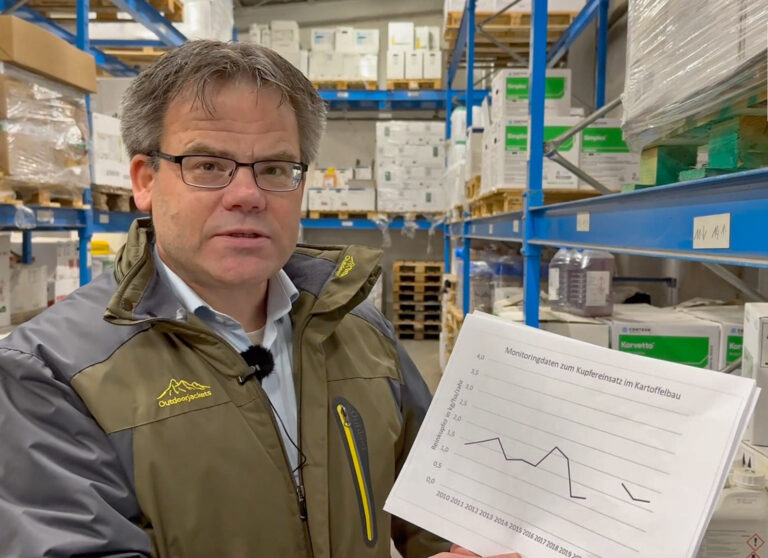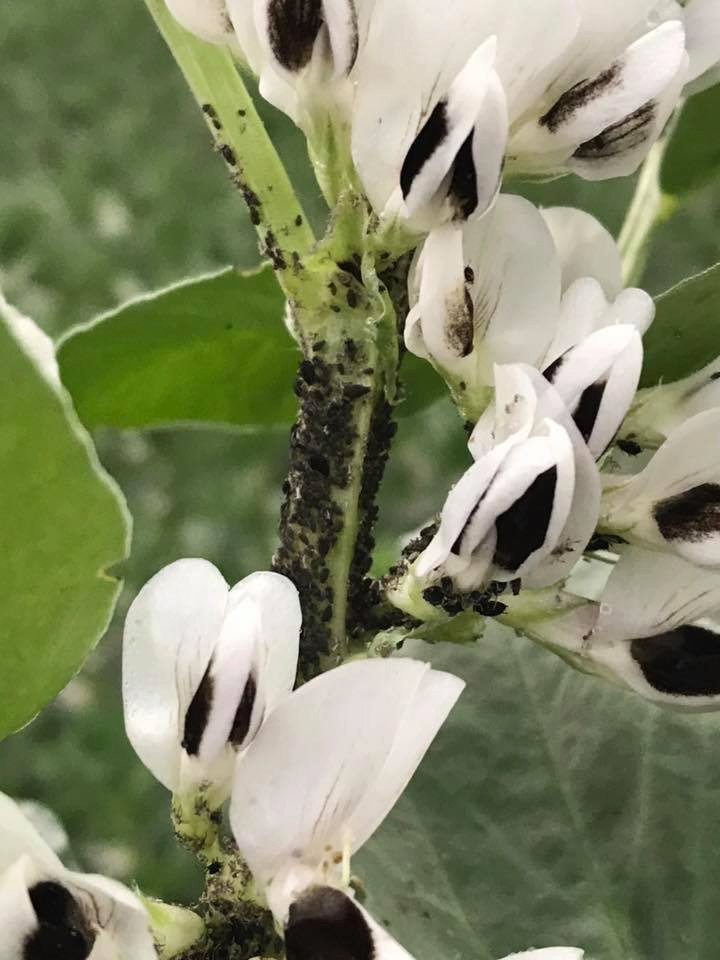Die Frage, was junge Landwirtinnen und Landwirte beschäftigt, haben wir uns gestellt, als wir uns auf den Besuch des Umwelt- und Agrarausschusses des Landtages Schleswig-Holstein vorbereitet haben. Wir wollten den Mitgliedern des Ausschusses fünf Positionen unterbreiten, die deutlich machen, was sich auf landespolitischer Ebene ändern muss, damit die Junglandwirtinnen und Junglandwirte auch in Zukunft noch stolz Betriebe übernehmen und führen können.
Zur Strukturierung unserer Forderungen und Positionen haben wir sie in einem Positionspapier festgehalten. Dieses konnten wir im Anschluss dem Vorsitzenden des Umwelt- und Agrarausschusses, Heiner Rickers (CDU), übergeben. Von einer Delegation von fünf jungen Landwirtinnen und Landwirten, bestehend aus Laura Stolley, Sven Reimers, Nils von Spreckelsen, Mirco Engelbrecht und Tessa Nafziger, wurde die Landjugend repräsentiert. Am 11. Februar konnten wir zuerst einen Teil einer laufenden Debatte zum Thema Naturschutz verfolgen und anschließend selbst unsere Inhalte einbringen.
Wir als Landjugend Schleswig-Holstein machen in unserem Positionspapier deutlich, dass wir von der Landespolitik ein klares Bekenntnis zur Zukunft der Landwirtschaft erwarten. Wir betonen, dass unsere Generation täglich erlebt, wie politische Entscheidungen Betriebe prägen und wie sehr Verlässlichkeit und Planungssicherheit fehlen.
Zentral ist unsere Forderung nach einer eindeutigen politischen Zusage, dass Landwirtschaft in Schleswig-Holstein als wichtiger Wirtschaftszweig gewollt ist. Dazu verlangen wir die Stärkung und Weiterentwicklung der Bildungsoffensive Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz (BiLEV), den Aufbau geförderter Netzwerke zwischen Produzenten und Verbrauchern sowie verbindliche Maßnahmen, die eine wirtschaftlich tragfähige Landwirtschaft bis mindestens 2050 sichern.
Mit Blick auf die Flächennutzung kritisieren wir, dass landwirtschaftliche Betriebe zunehmend in Konkurrenz zu Energie-, Infrastruktur- und Naturschutzprojekten geraten und dadurch Entwicklungsperspektiven verlieren. Wir fordern konsequenten Flächenschutz mit verhältnismäßigen Ausgleichsmaßnahmen, ein entschiedenes Vorgehen gegen außerlandwirtschaftliche Bodenspekulation und die Priorisierung bereits versiegelter oder minderwertiger Flächen für neue Projekte.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Hofübergabe als Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit der schleswig-holsteinischen Landwirtschaft. Wir verlangen ein landesweit gebündeltes Coaching- und Beratungsangebot zur Hofnachfolge, finanzielle Unterstützung für junge Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter, die dieses nutzen, sowie rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen, die Übernahmen erleichtern, etwa Erleichterungen bei Betriebsdarlehen.
Deutlich sprechen wir auch die Rolle von Gesetzen als Innovationsbremse an. Wir fordern eine innovationsfreundliche Gesetzgebung, eine dauerhafte Innovationsklausel für die schnelle Einführung neuer Technik und Verfahren sowie eine gezielte Förderung von Bildungs- und Wissenstransferprojekten, damit Innovationen auf den Betrieben ankommen können.
In der Tierhaltung machen wir die Spannungen zwischen langfristigen Investitionen und kurzlebigen politischen Vorgaben deutlich. Wir verlangen verlässliche Übergangsfristen für bestehende Ställe, widerspruchsfreie Regelungen, die Tierwohl, Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit zusammenbringen, sowie ein klares Leitbild der Landesregierung zur Tierhaltung 2050, das jungen Landwirtinnen und Landwirten Investitionssicherheit gibt.
Am Ende stellen wir klar, dass diese Forderungen nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern politisch umgesetzt werden müssen, damit junge Menschen Vertrauen in die Rahmenbedingungen entwickeln können. Wir signalisieren unsere Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, und machen deutlich, dass nun die Politik am Zug ist. Wir bedanken uns für ein produktives Gespräch auf Augenhöhe und freuen uns, die Gespräche weiter zu vertiefen, um Landwirtschaft in Schleswig-Holstein 2050 nicht nur möglich zu machen, sondern auch attraktiv zu gestalten.