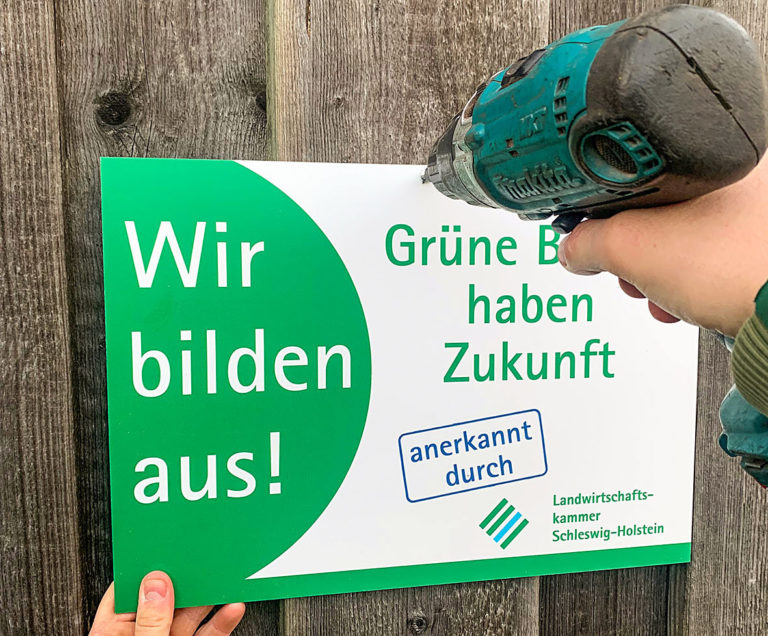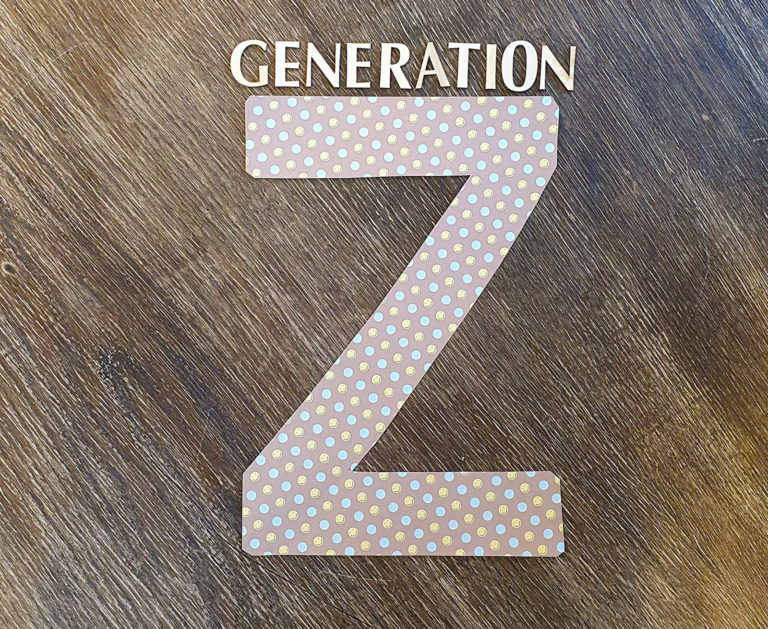Nach dem Corona-Aus 2020 hat die Laju mit einem ersten Planungswochenende erneut die Vorbereitungen für den Deutschen Landjugendtag gestartet, bei dem sich Landjugendliche aus dem gesamten Bundesgebiet treffen. Die Laju Schleswig-Holstein sieht den DLT als Chance zu zeigen, was ihre Heimat zwischen den Meeren zu bieten hat. Und so heißt es : „Segel setzen – Flagge zeigen!“.
Bei einer Veranstaltung dieser Größe gibt es allerdings so einiges, das angepackt werden muss. Es wird mit zirka 1.000 Besuchern gerechnet, die allesamt untergebracht, verpflegt und vor allem unterhalten werden wollen. Erste Ideen wurden bereits bei einem lockeren Auftakttreffen in der Geschäftsstelle in Rendsburg gesammelt. Nun soll es aber handfest werden. Daher stand Anfang Februar das erste Planungswochenende in Sorgbrück an.
Auf der Tagesordnung stand neben einem allgemeinen Austausch, der Gründung der einzelnen Projektgruppen und vertiefter Bearbeitung einiger Themen auch das gegenseitige Kennenlernen. Schließlich ist eine Gruppe motivierter Leute noch lange kein Team. Das Referententeam sorgte mit Spielen wie Personen-Bingo, „Mein rechter, rechter Platz ist leer“ und „Obstsalat“ nicht nur für Kindheitserinnerungen, sondern auch für eine Menge Spaß. Ganz anders beim Spiel „Ameisenkönigin“, zu dem so mancher eine Art Hassliebe entwickelte. Ziel des Spiels ist es, in festgefahrenen Situationen oder nach dem allseits bekannten Mittagstief neuen Schwung zu finden. Für alle, die nicht das Glück hatten, zur Ameisenkönigin ernannt worden zu sein, endete diese Übung leider damit, eine auf dem Rücken liegende Ameise zu imitieren.
An diese Warm-ups (oder auch Wups genannt) schlossen sich erste inhaltliche Gespräche an, bei denen es zunächst zu klären galt, ob bereits bestehende Pläne oder das schon vorliegende Logo beibehalten werden sollten. Das war häufig diskutiert worden, aber in Sorgbrück waren sich alle darin einig, dass die Planung noch einmal neu angegangen wird. Schließlich hat sich die Laju in den vergangenen drei Jahren weiterentwickelt, und das soll sich auch beim DLT 2024 widerspiegeln.
So stellten sich erneut grundlegende Fragen wie „Wo soll der DLT 2024 stattfinden?“, „Wie machen wir möglichst gute Werbung?“ oder „Welche Aktionen wollen wir anbieten?“. Da es kaum zielführend ist, solche Fragen in einer großen Gruppe von über 20 Leuten auszudiskutieren, wurden die Teilnehmenden nach Interessen auf die Projektgruppen Platz, Öffentlichkeitsarbeit, Party, Exkursionen und Theater aufgeteilt. Nach dem Mittag verbrachten wir den Rest des Tages damit, in den einzelnen Untergruppen erste Konzepte zu besprechen und gedanklich oder schriftlich offene To-dos festzuhalten.
Den Abend ließen wir dann mit der Dokumentation über den DLT 1993, der auch schon in Schleswig-Holstein stattfand, und der Aufzeichnung des Theaterstücks der Grünen Woche 2016 ausklingen.
Nach für viele etwas zu wenigen Stunden Schlaf und einem leckeren Frühstück ging es dann an die Ergebnispräsentation. Die einzelnen Untergruppen stellten vor, was sie ausgearbeitet hatten, und diskutierten den einen oder anderen Punkt noch einmal in der gesamten Runde. Gegen Mittag war es geschafft und gemeinschaftlich wurde aufgeräumt und das Resümee gezogen.
Derzeit sind noch viele grundlegende Punkte offen. Das DTL-Team geht aber zuversichtlich an die bevorstehenden Aufgaben und alle freuen sich auf die nächsten Treffen. Der Auftakt ist auch gut gelungen, weil im Gästehaus Sorgbrück nicht nur für eine leckere Verpflegung, sondern auch für großartige Unterbringung gesorgt war.
Wer den Prozess der Vorbereitung weiter mitverfolgen möchte, kann dem DTL-Team auf Instagram folgen unter @deutscher_landjugendtag
Auch weitere Helfer können gern mit an Bord kommen. Infos und Anmeldung zum nächsten Projektgruppentreffen unter info@dlt2024.de