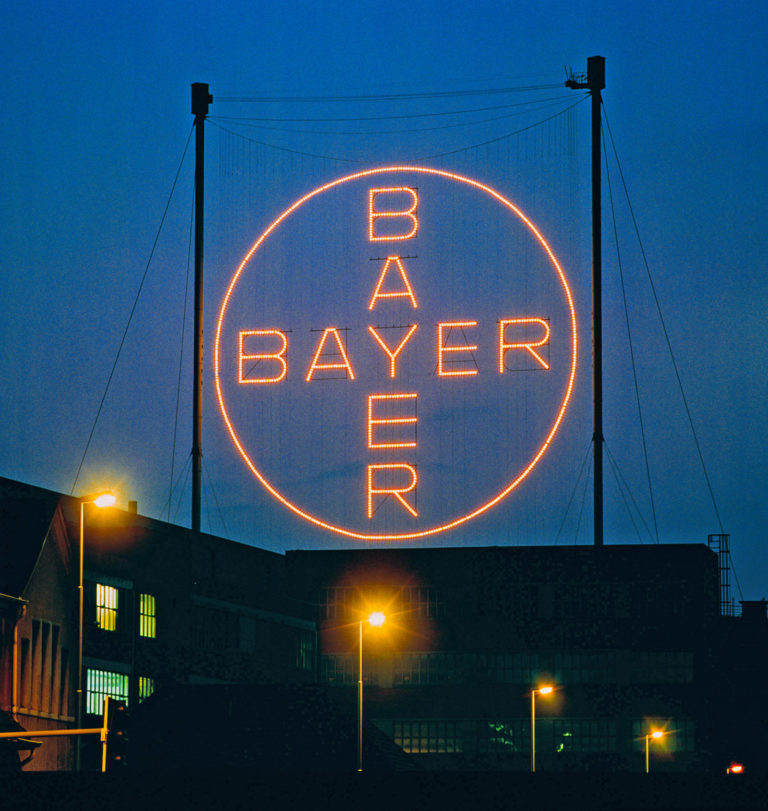Die Haltung im Offenstall erfüllt die natürlichen Bedürfnisse von Pferden in puncto Bewegung, Licht, Luft und Sozialkontakten am besten. In der Theorie also perfekt, doch in der Praxis hapert es oft. Das liegt meist nicht am Vierbeiner, sondern am Offenstall, der schlichtweg nicht zum Pferd passt. Doch gibt es überhaupt pferdefreundliche Alternativen?
Der Begriff „Offenstall“ kann weit gefasst werden: Vom knietiefen Matschplatz mit notdürftigem Unterstand bis hin zum Aktivstall mit ausgeklügelter Raumaufteilung und computergesteuerter Fütterung fallen zahlreiche Varianten in diese Kategorie. Nicht alles, was sich Offenstall nennt, ist auch wirklich pferdegerecht. Pferdebesitzer, die bereits schlechte Erfahrungen gesammelt haben, sind nicht selten überzeugt: „Mein Pferd ist nicht für den Offenstall geeignet.“
Damit sich das Pferd wohlfühlen kann, müssen einige Grundvoraussetzungen erfüllt sein, etwa ausreichend Platz. In den „Leitlinien zur Beurteilung von Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) sind unter anderem die Mindestvoraussetzungen für die Gruppenhaltung von Pferden angegeben. Nicht alle Pferde kommen allerdings mit diesen Mindestmaßen zurecht. Einige werden in der Folge aggressiv oder lethargisch und mitunter vorschnell als „offenstalluntauglich“ abgestempelt. Wäre mehr Platz vorhanden, würden vermutlich auch mehr Pferde in einem Offenstall gut zurechtkommen. Daher gilt: Großzügige Liegemöglichkeiten, reichlich Auslauffläche und genügend Fressplätze tragen entscheidend dazu bei, dass das Konzept Offenstall funktioniert.
Auch die räumliche Situation ist wichtig: Hat der Liegebereich zwei Ausgänge, ist er eher quadratisch oder ein langer Schlauch, gibt es Raumteiler? Für Pensionspferdebetriebe ein Dilemma: Es ist natürlich einfach, auf dem Papier mehr Platz zu fordern. Betriebe möchten ihren Einstellpferden auf der einen Seite einen guten Platz bieten, auf der anderen Seite macht es wirtschaftlich einen Unterschied, wie viele Pferde auf der vorhandenen Fläche untergebracht sind. Schließlich haben viele Betriebe unter den aktuellen Bedingungen ohnehin schon schwer zu knabbern.
Bedürfnisse der Pferde berücksichtigen
Das tägliche Stallmanagement trägt ebenfalls entscheidend dazu bei, ob die Vierbeiner sich im Offenstall wohlfühlen – oder eben nicht. Hierzu zählen beispielsweise geringe Fluktuation und individuelle Fütterung. Bei ständigem Pferdewechsel entsteht Unruhe. Die Rangordnung muss jedes Mal neu geklärt werden, was zu vermehrten Rangeleien und mitunter Verletzungen führt. Auch in Gruppenhaltung sollte es möglich sein, jedem Pferd seine individuelle Futterportion zuzuteilen. Das ist zugegebenermaßen eine Herausforderung und kann nur durch Fressständer oder computergestützte Fütterung gewährleistet werden. Alternativ müssen die Pferdebesitzer mehr eingebunden werden, also etwa Kraftfutter selbst zufüttern. Selbstverständlich müssen darüber hinaus die Sauberkeit stimmen, die Qualität des Futters einwandfrei sein und der Stallbetreiber über fundiertes Fachwissen und Erfahrung verfügen.
Bleiben noch die Vierbeiner selbst, die mitbestimmen, ob es im Offenstall klappt. Grundsätzlich sollte die Herde nicht allzu bunt gemischt sein, da die Anforderungen an den Stallbau dann enorm sind. Vor allem (Gitter-)Abstände sind problematisch, denn was für einen mächtigen Kaltbluthuf keine Gefahr darstellt, kann für einen zierlichen Ponyhuf zur Falle werden. Unterschiedliche Altersstufen sind im Offenstall grundsätzlich kein Problem. Allerdings sollten sehr junge Pferde immer gleichaltrige Freunde haben, sehr alte Pferde hingegen sind mitunter mit Youngsters überfordert.
In gemischten Pferdeherden können Wallache, die sich wie Hengste benehmen, zu einem großen Problem werden. Schließlich sind Stutenbesitzer nicht erfreut, wenn der Wallach regelmäßig auf den Rücken ihrer Stute springt – abgesehen von der Verletzungsgefahr. Zudem gibt es noch den „Problemfall“ Hengst. Zwar kommt eine Studie der Freien Universität Berlin zu dem Schluss, dass Hengste durchaus in Gruppen gehalten werden können, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Eine wirklich artgerechte Haltung von Hengsten im Offenstall ist dennoch eine enorme Herausforderung.
Grundsätzlich kann also (fast) jedes Pferd im Offenstall gehalten werden, wenn auf die Bedürfnisse der Bewohner eingegangen wird. Allerdings ist es für Pferdebesitzer schlichtweg nicht immer möglich, einen solchen optimal auf die Bedürfnisse ihres Vierbeiners zugeschnittenen Offenstall zu finden, noch dazu in angemessener Entfernung. Dann muss ein adäquater Kompromiss her.
Eine Innenbox stellt eigentlich keine Alternative dar, denn diese Haltungsform ist oft nicht pferdegerecht: Ein so großes Tier auf einer Fläche von etwa 12 m2 für viele Stunden am Tag einzusperren, sollte heutzutage nicht mehr sein. Ein Pferd braucht freie Bewegung und Artgenossen. Es gibt sicher Betriebe, die trotz Innenboxenhaltung den Pferden ausreichend Auslauf mit Artgenossen bieten, allerdings stehen noch immer zu viele Pferde zu viele Stunden in zu engen Innenboxen. Übrigens: Freie Bewegung heißt, das Pferd darf selbst bestimmen – Führanlage oder Laufband zählen also nicht dazu.
Bewegung, Kontakte, Licht und Luft
Eine Verbesserung der reinen Innenbox ist die sogenannte Kurtz-Box, benannt nach ihrem Erfinder Andreas Kurtz. Ein Teil der Zwischenwand ist hier durch senkrechte Gitterstäbe ersetzt, die bis zum Boden reichen. Die Pferde können den Kopf hindurchstrecken und so besser Kontakt zum Nachbarn aufnehmen, beispielsweise gegenseitig Fellpflege betreiben. Vor allem für Hengste, die ja zum Großteil in Einzelboxen leben, kann dies eine Verbesserung sein. Der tägliche Auslauf muss dennoch gewährleistet werden.
Außenboxen sind nicht viel besser zu bewerten als Innenboxen, zumindest was den Platzbedarf und den Kontakt zum Nachbarn betrifft. Den Pferden wird hier lediglich die Möglichkeit geboten, hinauszuschauen, was die Langeweile ein wenig abmildern kann und für besseres Stallklima sorgt. Ansonsten überwiegen wie auch bei der Innenbox die Nachteile und es muss entsprechend für ausreichende Bewegung und Kontakte mit anderen Pferden gesorgt werden.
Viele Pferde leben mittlerweile in Paddockboxen. Diese Boxen mit direkt angrenzender Terrasse bieten zum einen mehr Platz als reine Boxen, außerdem können die Pferde frei entscheiden, wann sie draußen stehen und wann lieber nicht. Das gilt natürlich nur, wenn die Tore zum Paddock bei schlechtem Wetter nicht geschlossen werden, was leider in manchen Betrieben durchaus Usus ist.
Als Mittelweg zwischen Innen- und Paddockbox wird mitunter der Zugang zum Paddock nachts grundsätzlich verschlossen, beispielsweise wenn sonst nicht sichergestellt werden kann, dass nachts kein Unbefugter von außen an den Stall gelangt. Paddockboxen können allerdings auch nur dann eine mögliche Alternative zum Offenstall sein, wenn die Pferde zusätzlich täglich bei jeder Witterung mehrere Stunden gemeinsam mit Artgenossen auf die Weide oder auf einen Schlechtwetterauslauf dürfen. Schließlich ist die Bewegungsmöglichkeit im Paddock, der meist in etwa so groß ist wie die Box, doch sehr begrenzt.
Einige Pferdebetriebe bieten Minioffenställe an, also Offenställe, in denen vielleicht nur zwei oder vier Pferde zusammenleben. Gerade für Vierbeiner, die bereits älter sind oder sich grundsätzlich in größeren Herden schwertun, ist dies oft eine durchaus gute Lösung. Diese Minioffenställe können auch – wenn baulich möglich – durch das Zusammenlegen von zwei oder mehreren benachbarten Paddockboxen erstellt werden. Solche flexiblen Boxensysteme müssen aber schon beim Stallbau mit eingeplant werden, nachträglich ist eine solche Veränderung oft nur schwer umsetzbar.
Weidehaltung braucht gutes Management
In Laufställen wohnen die Pferde gemeinsam in einem Innen- oder Außenstall, der idealerweise in Liege- und Fressbereich unterteilt ist. Wichtig ist, dass der Stall entsprechend großzügig dimensioniert ist und die Vierbeiner zusätzlich täglich an die frische Luft dürfen. Allerdings ist diese Haltungsform in Pensionsställen selten zu finden, eher in Gestüten oder Aufzuchtställen.
Eine weitere Alternative zum Offenstall ist die ganzjährige Weidehaltung. Diese entspricht dem Herden- und Lauftier sehr, stellt aber große Anforderungen an das Management. Notwendig sind unter anderem ein geeigneter Standort mit entsprechender Bodenbeschaffenheit, sehr große Flächen für wenige Pferde, ein stets trockener, zugluftfreier und eingestreuter Unterstand, ganzjährige frostfreie Wasserversorgung sowie befestigte Futterplätze für die Zufütterung. Sonst wird aus der ganzjährigen Weidehaltung recht schnell eine matschige, unhygienische Angelegenheit.
Von den gängigen Haltungsformen kommt der Offenstall den grundlegenden Bedürfnissen der Lauf- und Herdentiere am nächsten. Viele Pferdebesitzer haben das erkannt, weshalb sich Offenställe großer Nachfrage erfreuen. Kritiker führen gern das Argument an, dass nicht jedes Pferd für die Haltung im Offenstall geeignet sei. Meist ist es aber vielmehr so, dass der Offenstall nicht zum Vierbeiner passt, da dessen individuelle Ansprüche nicht berücksichtigt werden (können), beispielsweise wenn der Vierbeiner ein großes Platzangebot benötigt, der Offenstall aber „nur“ Mindestmaße bietet. Auch die Entfernung vom Wohnort des Besitzers spielt eine wichtige Rolle, schließlich soll die tägliche Fahrt in den Stall nicht zum Zeiträuber werden – ganz abgesehen von den hohen Spritkosten.
Um all das unter einen Hut zu bringen, können beispielsweise eine große Paddockbox mit täglichem Auslauf, ein Minioffenstall, ein Laufstall oder die ganzjährige Haltung auf der Weide eine akzeptable Alternative zum Offenstall darstellen. Werden Pferde in Innen- oder Außenboxen gehalten, sollten sie sehr viel Zeit außerhalb dieser vier Wände verbringen, und zwar gemeinsam mit ihresgleichen.