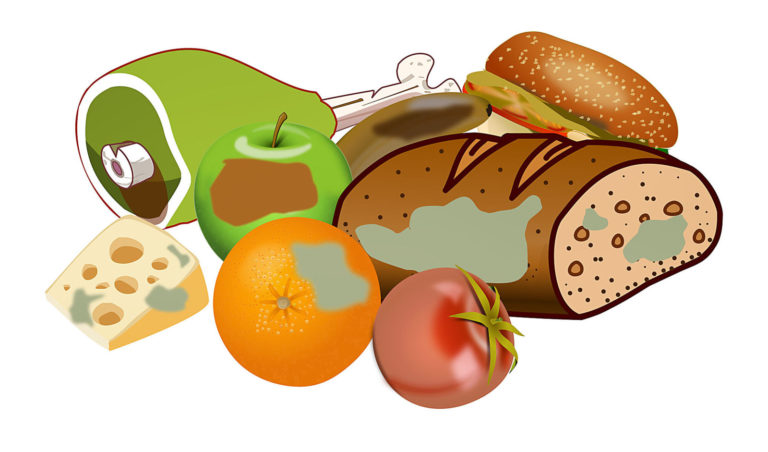Auch an den drei Tagen des Landesponyturniers, das nach den Wettkämpfen der Reit- und Fahrvereine in Bad Segeberg stattfand, gab es viel Regen. Doch Turnierleiter Tim Streichert war am Sonntagabend trotzdem mehr als zufrieden. Er berichtete von vielen Startern, glücklichen Kinderaugen, tollem Sport und Helfern, die sich dafür bedankten, dass sie helfen durften.
„Schon am Freitag im Gelände waren wir mehr als erstaunt über die vielen Starter“, berichtete Tim Streichert aus Bebensee, Kreis Segeberg. Er ist Teil des Organisationsteams des Reit- und Fahrvereins Bad Segeberg, von dem das Landesponyturnier organisiert wird, und rechnet eigentlich immer mit einem bestimmten Prozentsatz, der nicht kommt. „Es waren aber fast 100 Prozent da. So waren wir zwar etwas im Zeitverzug, aber das sind ja Luxusprobleme“, freute er sich. Auch das Gespräch mit den Richtern auf der Geländestrecke sei durchweg positiv gewesen: „Die Ritte waren hervorragend. Alle hatten super trainiert.“ Die hohe Qualität zog sich für Streichert durch das ganze Wochenende. „Die waren alle richtig heiß und hatten sich bestens vorbereitet.“
Das galt auch für die Reiter des Fehmarnschen Ringreitervereins. Das Team um Julia Marrancone gewann den Wettkampf um die Landesponystandarte mit 66,32 Punkten. „Es war sehr spannend“, berichtete Streichert und fand auch hier noch einen Grund mehr zur Freude: „Mit 24 Mannschaften hatten wir mehr Abteilungen als bei den Pferden.“ Zweiter wurde die Reitgemeinschaft Groß Buchwald um Margret Doose (65,66) vor dem Team von Pferdesport Granderheide um Brigitte Hilger (65,54). Der Aufmarsch der Ponyreiter aus den Vereinen war dann der Gänsehautmoment des Wochenendes. Die 100 Ponys passten in einer Reihe gerade so auf den Platz.
Strahlende Gesichter
„Und dann kam die Sonne raus“, erzählte ein bewegter Streichert, der sogleich unterstrich: „Die strahlenden Kindergesichter sind der Lohn für die ganze Arbeit, die wir in das Turnier gesteckt haben.“ Das gesamte Veranstalterteam macht die Arbeit ehrenamtlich. „Wir brennen für die Jugend und den Ponysport. Wir haben so viel Lob bekommen und das ist ein tolles Gefühl“, so Tim Streichert, der auch Mitglied der Bundesjugendleitung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) ist.
Auf dem Landesponyturnier hatten auch die Nachwuchsvierbeiner die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Das Schleswig-Holstein-Championat der fünfjährigen Dressurponys entschied Genial für sich. Der Deutsche Reitponywallach wurde von seinem Besitzer Tjore Schmielau vorgestellt. Bei den Vierjährigen siegte Steendieks Daddys Sunny Boy. Der Hengst aus der Zucht und dem Besitz von Peter Böge bekam mit seiner Reiterin Mareike Peckholz eine 8,9. Peckholz stellte auch Steendieks My Lord vor und holte mit einer 8,1 für den Hengst den Vizetitel bei den Dreijährigen. Sieger wurde Grenzhoehes Diarado (8,2) aus der Zucht und dem Besitz von Sabine Reimers-Mortensen. Im Sattel saß Linda Boller.
Das Schleswig-Holstein-Championat der Springponys gewann Freienfeldes Ruck-Zuck mit Anna-Marie Frahm im Sattel. Der Wallach stammt aus der Zucht und dem Besitz von Swantje Hinz.
Erfolgreicher Nachwuchs
Neben den Championaten wurden auch die Landesmeisterschaften der Ponyreiter ausgetragen. Andra-Sophie Lorentz pilotierte den Deutschen Sportponyhengst Cappo zum Sieg in der Landesmeisterschaft Springen. In beiden Wertungsprüfungen und im abschließenden L-Springen legte das Paar fehlerfreie Runden hin. Ebenfalls fehlerfrei, aber einen Hauch langsamer war Leni Hansen mit Cherry-Kiss. „Das war ein sehr spannendes Stechen“, befand Tim Streichert. „Wir hatten wirklich tolle Reiterinnen und auch Reiter, denn es waren einige Jungs am Start. Es war zum Teil Wahnsinn, wie die hier die Kurse geritten sind.“ Das galt auch für die Buschreiter, bei denen sich Jona Isabell Heine mit Sandro den Titel holte. Vizemeisterin wurde Iliane Hannalisa Hein mit Little Tuffstuff.
Filina Joelle Stürken ist die neue Landesmeisterin in der Dressur. Mit Bali vM holte sie in den drei Prüfungen 216,59 Punkte und gewann so vor Carolin Ehrlich (213,55), die mit Dancing Daylight die dritte Wertung für sich entschieden hatte.
Auch das Finale des Jugendcups Fahren fand in Bad Segeberg statt. Mit einer sehr guten Vorstellung und einer glatten 10,0 siegte Mia Lotta Sonnwald mit ihrer Welsh-B-Stute Mon Chéri. Das Paar hatte zuvor auch schon die Dressur und das Hindernisfahren gewonnen.
Am Ende resümierte Tim Streichert: „Alles war gut, bis auf das Wetter.“ Und als sich dann die Helfer, bei denen er sich zum Abschied bedanken wollte, mit „Danke, dass ich helfen durfte“, verabschiedeten, waren die Strapazen der Vorbereitung und Durchführung schon fast vergessen.