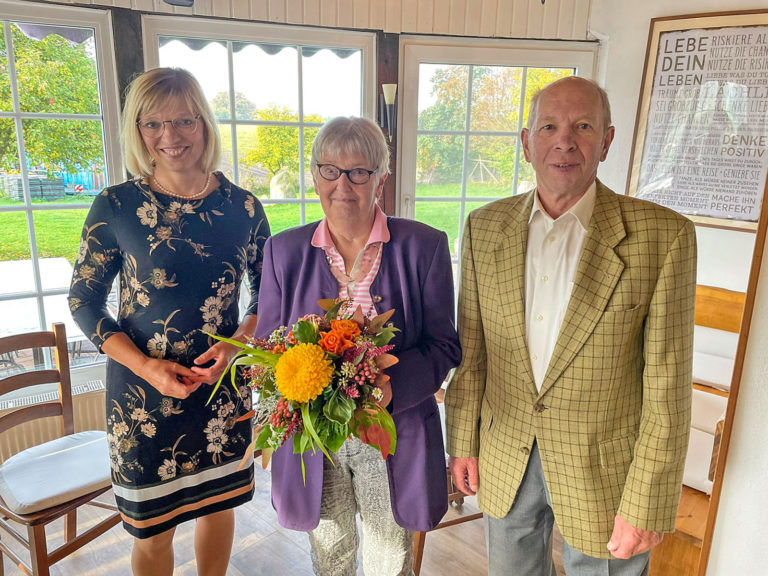Stoffwechselprodukte des Bakteriums Clostridium botulinum sind für die Ausprägung des Krankheitsbilds Botulismus verantwortlich. Dieses Botulinumtoxin gehört zu den stärksten Giften weltweit. Clostridien können sich besonders schnell in eiweißhaltigen Stoffen ausbreiten, wie beispielsweise in einem Tierkadaver. Gelangt dieser ins Futter, zum Beispiel bei der Ernte oder im Kraftfutterlager, können auch Pflanzenfresser an Botulismus erkranken. Es besteht dann Lebensgefahr für das Tier. Wie entstehen die Toxine?
Clostridium botulinum wächst unter Luftabschluss, daher vermehrt es sich gerade in Silagen gut. Die Anwesenheit von kleinen Mengen Sauerstoff führt dabei nicht sofort zum Absterben der Bakterien, sondern fördert als Stressfaktor noch die Toxinbildung. Clostridien können sich besonders schnell in eiweißreichen Stoffen vermehren, wie beispielsweise in Tierkadavern, aber auch in Biertreber.
Clostridien bilden Dauerformen (Sporen), die mehrere Hundert Jahre im Boden überleben können, um sich unter günstigen Umweltbedingungen wieder in die aktive, Toxin bildende Variante zurückzuverwandeln.
Risikofaktoren für die Kontamination von Futter mit dem Botulinumtoxin können Tierkadaver sein, die bei der Ernte oder der Lagerung ins Futter geraten (zum Beispiel ein toter Hase in der Grassilage oder verendete Mäuse oder Katzen im Kraftfutter). Auch eine Verschmutzung des Futters über clostridienhaltigen Vogelkot ist möglich. Da Clostridien überall an vielen Stellen im Boden vorkommen, sind auch größere Mengen an Sand oder Erde in der Silage ein Risikofaktor. Weiterhin kann die Düngung von Grünland mit erregerhaltiger Gülle oder erregerhaltigem Festmist (hierbei gilt insbesondere Geflügelmist als besonders riskant), Klärschlamm oder Gärresten aus Biogasanlagen für eine Kontamination verantwortlich sein.
Wie sieht das Krankheitsbild aus?
Das Botulinumtoxin wirkt auf die Nerven, die die Muskulatur des Bewegungsapparates, die Zungen-, Kau-, Schluck- und Bauchmuskeln sowie die Atemmuskulatur versorgen, und lähmt diese. Hierdurch zeigen sich beim klassischen Botulismus folgende Symptome:
Zunächst fällt der Rückgang von Futteraufnahme und Milchleistung auf, es kommt vermehrt zum Stolpern, die Tiere zeigen einen unsicheren Gang und sie liegen häufiger. Ihre Trinkverhalten ist gestört, sie speicheln vermehrt, der Lidschlussreflex ist gestört, Durchfall tritt auf. Im weiteren Verlauf kommt es zu einer Zungen- und Schlundlähmung mit der Unfähigkeit zu kauen und zu schlucken. Die Zunge hängt aus dem Maul, welches sich widerstandslos öffnen lässt. Die Bauchdecke ist eingefallen, die Harnblase ist gelähmt (es erfolgt kein Harnabsatz; wenn, dann nur tröpfelnd). Das Tier liegt fest mit eingeschlagenem Kopf, der Schwanz kann nicht mehr an den Körper gezogen werden. Im Endstadium tritt der Tod durch Atemlähmung ein. Es müssen nicht immer alle Symptome bei jedem Tier zu beobachten sein.
Beim atypischen Verlauf des klassischen Botulismus zeigt sich eine Muskelschwäche mit aufsteigender Lähmung, die von der Hinterhand ausgeht. Oftmals sind am Kopf keine klinischen Symptome zu beobachten. Auch hier tritt der Tod durch die Lähmung der Atemmuskulatur ein.
Chronisch-viszeraler Botulismus
Seit Mitte der 1990er Jahre scheint in einzelnen, vor allem norddeutschen Milchviehherden eine schleichende Form der Erkrankung aufzutreten, die allein durch den Verzehr von kadaververseuchtem Futter nicht zu erklären ist. Einige Wissenschaftler bezeichnen diese Erkrankung als chronisch-viszeralen (eingeweidebezogenen) Botulismus, betroffene Landwirte und Tierärzte stimmen dem zu.
Bei diesem Krankheitsbild liegt eine große Bandbreite an klinischen Symptomen vor. Es wird eine Toxiko-Infektion vermutet:
• Clostridium botulinum wird mit Futter (oder Wasser) aufgenommen.
• Die Clostridien bilden die Toxine im Darm der Tiere, gefördert durch Fütterungsfehler (zum Beispiel führen subklinische Azidosen zu unterschwelligen Schleimhautentzündungen und zu Verschiebungen der Pansen- und Darmflora).
• Die Toxinbildung im Darm ist wesentlich geringer als die Mengen, die mit dem Futter aufgenommen werden, daher verläuft diese Art der Erkrankung schleichend mit unspezifischen Symptomen unter Umständen über Monate bis Jahre.
Es kommt zum Leistungsrückgang mit Abmagerung und Teilnahmslosigkeit. Auch hier wird ein schwankender, unsicherer Gang beobachtet, sowie Speicheln und Schluckstörungen. Hinzu kommen Durchfall und Verstopfung in einer Gruppe, aufgezogene Bauchdecken, Pansenstillstand, gehäufte Labmagenverlagerungen, Wehenschwäche, Nachgeburtsverhaltungen, lebensschwache neugeborene Kälber sowie schwere Entzündungen.
Wie wird Botulismus festgestellt?
Beim klassischen Botulismus lassen typische Symptome auf die Erkrankung schließen, eine Diagnose kann aber beim atypischen Verlauf auf jeden Fall problematisch sein. Auch beim klassischen Verlauf müssen nicht alle typischen Symptome vorhanden sein. Der Fund von Tierkadavern im Futter untermauert die klinische Diagnose.
Die Symptome des chronisch-viszeralen Botulismus sind zu unspezifisch, um eindeutige Rückschlüsse auf die Erkrankung durch Clostridium botulinum zu erlauben. Da zudem Clostridium botulinum auch bei gesunden Tieren im Darm vorkommt, ist der Nachweis des Erregers im Darm ebenfalls wenig hilfreich.
Herdenbezogene Maßnahmen
Am wichtigsten ist das Absetzen des verdächtigen oder nachgewiesernermaßen toxinhaltigen Futters.
In Deutschland ist für Rinder kein Impfstoff zugelassen. Bei nachgewiesenem Botulismus können Impfstoffe nach Einholen einer Impferlaubnis von den zuständigen Behörden aber importiert werden. Da kommerzielle Impfstoffe nur gegen die Toxine zweier Unterarten von Clostridium botulinum, Typ C und D, immunisieren, ist der Nutzen fraglich, wenn andere Typen nachgewiesen wurden.
Futterzusätze wie Prä- und Probiotika, Toxinbinder (zum Beispiel Leinsamen, Topinambur, Hefen, Bentonit) können eingesetzt werden, die Resultate sind sehr verschieden.
Bei Einzeltieren beachten
Die Erfolgschancen einer Behandlung sind bei bereits an Botulismus erkrankten Tieren sehr schlecht. Haben die Tiere erst das Fressen eingestellt, besteht keine Aussicht mehr auf Heilung. Da die Therapie in jedem Fall sehr zeit- und kostenaufwendig ist, sollte die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen mit dem Tierarzt abgesprochen werden.
Betroffene Tiere sollten in einen Tiefstreu-Laufstall verbracht werden, regelmäßig gewendet beziehungsweise hochgezogen werden und mittels einer Infusionstherapie unterstützt werden. Tiere, für die keine Aussicht auf Heilung besteht, müssen erlöst werden.
Prophylaxe unbedingt beherzigen
Da sowohl die Bakterien als auch das Botulinumtoxin mit Futter oder Wasser aufgenommen werden, muss hier darauf geachtet werden, den Eintrag möglichst gering zu halten.
Vermeidung der Kontamination aller Futterarten mit Tierkadavern oder Kadaverflüssigkeiten:
• Silage: vorheriges Absuchen der zu mähenden Flächen mit Hunden, Mährichtung sollte Fluchtmöglichkeiten offen lassen
• Kraftfutter: konsequente Schadnagerbekämpfung im Betrieb, Vermeidung von offenen Lagerstätten
• Tierkadaver bis zur Abholung so lagern, dass austretende Flüssigkeit auf keinen Fall in den Silostock oder in andere Futterlagerstätten laufen kann
Eintrag von Sand und Erde in die Futterration so gering wie möglich halten:
• Grünlandpflege: Grasnarbe geschlossen halten, Maulwurfshügel einebnen und eine ausreichende Schnitthöhe einhalten
• Siliergut nur in befestigte Silos einbringen (bei unbefestigten Silohaufen: schlechtere Verdichtung birgt hohe Gefahr von Erd- oder Sandeintrag bei Entnahme)
• Festfahren mit möglichst sauberen Reifen
• Fahrwege auf dem Betrieb befestigen (bei unbefestigten Wegen wird sonst sehr viel Erde/Schlamm mit den Traktorreifen auf den Futtertisch gebracht)
Vermeidung der Kontamination mit Vogelkot:
• Vogelschutznetze an Silostöcken anbringen und sämtliche Futterkomponenten so weit wie möglich abdecken
• Futtergewinnung von Überflutungsflächen (Wassergeflügel!) vermeiden
• keine Grünlanddüngung mit Geflügelmist beziehungsweise -gülle
Hygiene im Kraftfutterlager ernst nehmen:
• Vermeiden von Schwitzwasserbildung
• Eindringen von Regenwasser verhindern
• Schadnagerbekämpfung
Biosicherheit bei der Düngung:
• bei bereits aufgetretenen Botulismusfällen im Bestand: keine Gülledüngung auf Grünland
• in jedem Fall: möglichst großen Abstand zwischen Gülledüngung und Schnittzeitpunkt einhalten
• keine Düngung mit Fremdgülle
• keine Düngung mit Gärresten von Biogasanlagen oder Klärschlamm
Fazit
Clostridien kommen häufig im Erdboden vor, daher lässt sich auch Clostridium botulinum nicht gänzlich aus den Beständen verbannen. Es sollte dennoch versucht werden, den Gehalt im Futter mit den oben beschriebenen Maßnahmen so gering wie möglich zu halten. Außerdem sollte das Abwehrsystem der Tiere durch eine optimierte Fütterung und Haltung gestärkt werden. Impfungen gegen die Toxine helfen in Beständen mit erhöhter Belastung, die Auswirkungen zu minimieren.