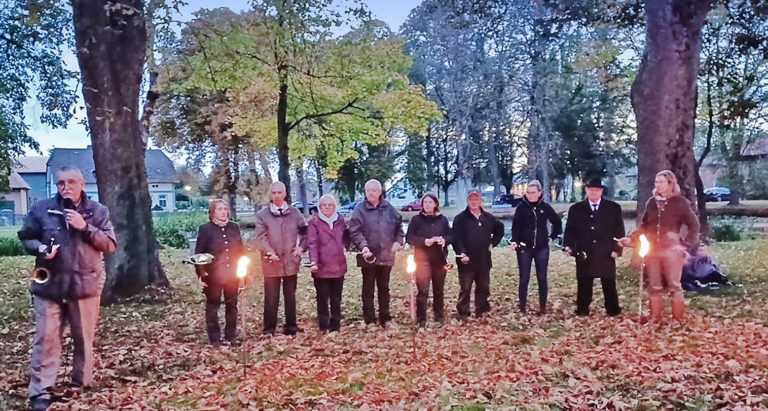Die Zufuhr von Nährstoffen über flüssige Wirtschaftsdünger spielt besonders auf intensiven Grünland- und Futterbaubetrieben eine essenzielle Rolle. Sofern diese bedarfsgerecht und verlustfrei auf den Grünlandflächen ausgebracht werden, können wirtschaftseigene Düngemittel einen Großteil des Nährstoffbedarfs der Bestände decken.
Der diesjährige Herbst war durch eine sehr warme Witterung mit einer außergewöhnlich langen Vegetationsperiode und damit verbundenem Graszuwachs gekennzeichnet. Wie sind in diesem Zusammenhang und auch grundsätzlich vergleichsweise späte Wirtschaftsdüngergaben im Grünland zu bewerten?
Grundsätzlich weisen Grünlandflächen eine intensive Durchwurzelung des oberen Bodenhorizontes auf und haben damit im Vergleich zu Ackerkulturen bessere Voraussetzungen für eine gute Verwertung wirtschaftseigener Düngemittel. Die Ausbringung stickstoffhaltiger Düngemittel ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn die Pflanzen einen Nährstoffbedarf aufweisen und die ausgebrachten Nährstoffe effizient aufgenommen und in Biomasse umgesetzt werden.
Aufgrund von abnehmenden Zuwachsraten ist von einem Nährstoffbedarf im Herbst in der Regel nicht auszugehen. Ein Abschwemmen von Nährstoffen in naturnahe Systeme beziehungsweise Oberflächengewässer ist zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund und insbesondere, um Nitratbelastungen im Grundwasser zu vermeiden, ist im Rahmen der Düngeverordnung eine Sperrfrist für die Ausbringung von N-haltigen Düngemitteln festgelegt. Auf Grünland, Dauergrünland und auf Ackerland mit mehrjährigem Feldfutterbau dürfen keine Düngemittel mit wesentlichem N-Gehalt (mehr als 1,5 % N in der TM) über die Wintermonate ausgebracht werden (siehe Tabelle). Ausgenommen von der Sperrfristregelung sind lediglich Festmist von Huf- und Klauentieren sowie Kompost, wobei für diese eine Sperrfrist vom 15. Dezember bis 15. Januar gilt (Sperrzeiten innerhalb der N-Kulisse abweichend und länger).
N-Ausnutzung im Herbst ist gering
Unter den maritimen Klimabedingungen Schleswig-Holsteins sind infolge der vergleichsweise warmen Böden im Herbst gute Mineralisations- und Nitrifikationsbedingungen gegeben, und es ist eine hohe N-Nachlieferung aus dem Boden zu erwarten. Besonders typische humusreiche Grünlandstandorte mit langjähriger organischer Düngung weisen ein hohes N-Nachlieferungsvermögen auf.
In diesem Herbst lagen die Temperaturen im Oktober und in der ersten Novemberhälfte deutlich über dem langjährigen Mittel und sorgten für eine zeitliche Ausweitung der Vegetationsperiode und Graszuwachs bis Mitte November. Die Folge sind überwachsene Bestände, die eine hohe Infektionsgefahr für Pilzkrankheiten aufweisen und einen späten Schröpfschnitt beziehungsweise eine Beweidung vor dem Winter benötigen (Hinweise zur Nutzung dazu sind in Kammer Kompakt, Ausgabe 47 erschienen). Durch eine zusätzliche organische N-Düngung kann die Überwüchsigkeit der Bestände bei milden Temperaturen nochmals verstärkt werden.
Es sollte beachtet werden, dass im Vergleich zur Frühjahrsausbringung aufgrund der hohen N-Nachlieferung aus dem Boden und relativ geringer Zuwachsraten nur eine geringere Stickstoffausnutzung aus der Herbstgülle realisiert wird. Ganz im Gegenteil zu dem Nutzen der Düngung erhöht sich die Gefahr, dass auswaschungsgefährdetes Nitrat in das oberflächennahe Grundwasser gelangt.
Versuche in Norddeutschland
In einer Versuchsreihe der Landwirtschaftskammer zur Herbstdüngung auf schnittgenutztem Grünland am Standort Schuby konnte ermittelt werden, dass von der im Herbst gedüngten N-Menge in der Gülle lediglich 25 % des enthaltenen Gesamt-N ertragswirksam umgesetzt werden konnten. Die im Herbst gedüngten Varianten zeigten zwar einen leicht höheren N-Ertrag im Vergleich zu den Frühjahrsvarianten, dieser war jedoch im Vergleich zu den Varianten mit ausgelassener Herbst-Gülledüngung nur marginal zwischen 20 und 40 kg N/ha höher.
Vergleichende langjährige Untersuchungen zu Gülledüngungsterminen im Herbst und Winter (80 kg N/ ha aus Rindergülle) und deren Effekt auf Nitratauswaschung über die Wintermonate sowie N-Ertragseffizienz des folgenden ersten Schnitts wurden auf dem Versuchsgut der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel im Östlichen Hügelland durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten, dass sich lediglich etwas über 20 % des Ende August applizierten Gülle-N im ersten Aufwuchs des Folgejahres wiederfanden (Abbildung).
Die Gülledüngung Ende September bis Ende November führte zu einer N-Effizienz im ersten Schnitt von nur etwa zirka 30 %. Die höchste N-Effizienz von über 45 % wurde jedoch bei einer Gülledüngung zwischen Ende Januar und Ende März erreicht (Abbildung). Eine Güllegabe Ende April in den bereits weit entwickelten Pflanzenbestand ist aufgrund der geringen N-Effizienz bei einer Ernte des ersten Schnitts Mitte/Ende Mai keine sinnvolle Alternative. Es handelt sich hierbei um scheinbare N-Wiederfindungsraten, die eine N-Mineralisation aus dem Boden oder Interaktionen mit Leguminosen wie Weißklee indirekt mitberücksichtigen.
Die Gülledüngung im August ist einer Gülledüngung in den Monaten September bis November vorzuziehen, denn die Untersuchungen haben gezeigt, dass zirka 25 % des im August applizierten Güllestickstoffs bereits sinnvoll vom letzten Aufwuchs im Jahr in Biomasse beziehungsweise Rohprotein umgesetzt und damit vor Auswaschung und gasförmigen Verlusten geschützt werden. Generell haben die Gülleapplikationen im Herbst und Winter zu erhöhten Nitratkonzentrationen im Sickerwasser geführt.
Zwischenfazit
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass unter den klimatischen Bedingungen Schleswig-Holsteins durch eine Gülledüngung im zeitigen Frühjahr deutlich höhere N-Ausnutzungen erzielt werden können als durch eine Düngung im Herbst, die schließlich zu erhöhten Nitratwerten im Sickerwasser sowie zu potenziell höheren gasförmigen N-Verlusten über Lachgas führt.
N-Bedarfsermittlung und Gülleabgabe
Wie und wann ist eine organische Düngung im Grünland beziehungsweise mehrjährigen Feldfutterbau nach dem letzten Schnitt im Rahmen der N-Düngebedarfsermittlung anzurechnen? Die Düngung nach der letzten Nutzung im Herbst wird dem Folgejahr und nicht dem aktuellen Düngejahr zugerechnet. Die Anrechnung der Herbstgüllegabe erfolgt wie bei einer Frühjahrsgabe, bei Rindergülle demnach mit 50 % (ab 1. Februar 2025 mit 60 %). Des Weiteren sind 10 % der Gesamt-N-Menge im Rahmen der Frühjahrsbedarfsermittlung als Nachlieferung aus organischer Düngung anzurechnen.
Bei einer ineffizienten Gülledüngung im Herbst gelangt also nicht nur wenig N in die erntebare Biomasse, im Vergleich zu einer unterlassenen Herbst-Gülledüngung muss die N-Düngung im Folgejahr stärker reduziert werden. Dadurch verringert sich die mögliche N-Düngemenge je nach ausgebrachter N-Menge im Herbst zu den ersten Schnitten im Folgejahr. Die ersten Schnitte machen jedoch Jahresertragsanteile von etwa 30 bis 45 % aus, sodass eine Reduktion der N-Düngung nicht ratsam ist, auch um die nötigen Proteingehalte zu realisieren.
Die Voraussetzung für eine effiziente Nährstoffausnutzung aus Gülle sind die Ausbringung bei optimaler Witterung und die passende Ausbringtechnik, um gasförmige Stickstoffverluste zu minimieren. Um dies zu erreichen, sind eine bodennahe Ausbringung (Schleppschuh, Schleppschlauch) oder zukünftig auch die Ansäuerung von Gülle von großer Bedeutung, um gasförmige N-Verluste zu minimieren und die N-Effizienz zu erhöhen.
Fazit
Eine Gülledüngung auf Grünland ist bis zum Einsetzen der Sperrfrist zwar grundsätzlich erlaubt, sollte aber nach August nicht mehr durchgeführt werden. Die Mineralisierung des organisch gebundenen N-Anteils bei einer Gülleapplikation im September oder Oktober erfolgt zu spät, wodurch bei einer zeitgleich geringen N-Aufnahme des Grasbestands das Risiko einer geringen N-Ausnutzung und erhöhter Nitratwerte im Sickerwasser im Spätherbst erhöht ist. Die höchste Gülle-N-Ausnutzung im Grünland ist durch Ausbringung im zeitigen Frühjahr realisierbar.