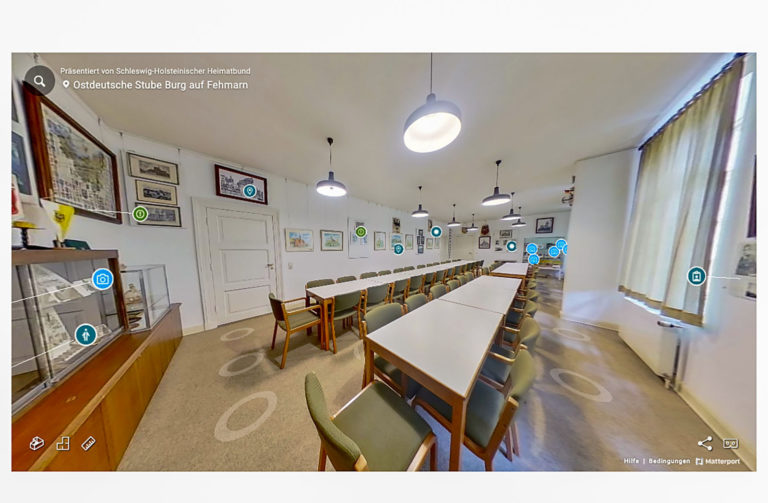Die Einführung der TMR-Technologie hat zweifellos die Leistungsentwicklung der Milchkühe in den vergangenen 30 Jahren geprägt. Sie ist ein ideales Instrument zur Umsetzung moderner Milchkuhernährung. Neben den arbeitswirtschaftlichen Vorteilen profitieren Rind und Landwirt vor allem von der Verringerung von Futterselektion und Grobfutterverdrängung sowie von der Optimierung der Pansenphysiologie durch Minimierung von pH-Wert-Schwankungen und Synchronisierung von Nährstoffabbau und -synthese.
Zudem wurde dem praktischen Tierernährer erstmals ein Instrument in die Hand gegeben, um die gefressene Ration der Milchkuh zu erfassen und zu analysieren. Damit konnten sowohl die Energie- und Nährstoffversorgung der Kuh optimiert, aber auch die Nährstoffausscheidung bewertet werden. Voraussetzung für dieses Tun ist jedoch, dass die Mischungen auch analytisch kontrolliert werden können.
Sinn oder Unsinn
Vor jeder laboranalytischen Kontrolle steht eine möglichst repräsentative Beprobung des Futtermittels. Diese ist jedoch gerade bei TMR-Mischungen eine echte Herausforderung und hält aktuell viele noch davon ab, TMR-Mischungen analytisch untersuchen zu lassen.
Glaubt man wissenschaftlichen Studien zur Repräsentativität von Einzelfuttermittelanalysen, dann sind immerhin allein 61 % der Fehlerquellen durch die Probenahme verursacht. Dies könnte bei TMR-Mischungen durchaus noch schlechter sein. Eine geübte und nach strengen Regeln praktizierte Probenahme entscheidet deshalb wesentlich über den Sinn oder Unsinn einer Laboranalyse für die Mischungen.
Diese Regeln kann man nachlesen zum Beispiel in der Verordnung VO (EG) 152/2009 (Ergänzung VO(EG) 691/2013) – Festlegung der Probenahmeverfahren für die amtliche Untersuchung von Futtermitteln http://eur-lex.europa.eu, der DIN EN ISO 6497: 2005 – Probenahme von Futtermittel zur Eigenkontrolle www.bvl.bund.de, im VDLufa-Methodenbuch Band III, 1 Probenahme www.vdlufa.de/Methodenbuch oder auch in länderspezifischen Empfehlungen.
Dort steht aber wenig beziehungsweise gar nichts über die Beprobung von TMR-Mischungen. Deshalb soll nachfolgend die Technik der Probenahme von TMR-Mischungen vorgestellt werden, welche seit vielen Jahren im Messnetz Futtermittel des Freistaates Sachsen und im Rahmen von vergleichenden Köllitscher TMR-Wagen-Tests erfolgreich praktiziert wird.
Erfahrungen
Jede Probenahme beginnt immer mit einer sensorischen Partieabgrenzung. Eine Partie ist als die Menge eines Futtermittels definiert, die sich nach ihrer Beschaffenheit, Deklaration oder/und räumlichen Zuordnung deutlich als Einheit darstellt. Bei TMR-Mischungen ist dies ziemlich eindeutig, da jede einzelne Mischung, das heißt Ration, de facto eine Partie darstellen sollte und muss. Wenn dies durch Sinnenprüfung nicht bestätigt werden sollte, ist dies das Resultat eines unzureichenden Mischvorgangs, was zwangsläufig eine Beprobung ausschließen sollte.
Bei der Sinnenprüfung von TMR-Mischungen ist insbesondere auf die Homogenität und gegebenenfalls mögliche Entmischung durch den Mischvorgang, das Austragen der Mischung oder die selektive Futteraufnahme durch die Rinder zu achten. Zudem sollte man die aerobe Stabilität (Erwärmung) oder das verstärkte Entweichen flüchtiger Bestandteile (Fermentationsprodukte) beachten, um ungerichtete Verluste zu minimieren.
Aus der abgegrenzten TMR-Partie müssen nach dem Zufallsprinzip möglichst gleich große Einzelproben an räumlich repräsentativ verteilten Stellen entnommen werden. Eine Beprobung direkt im Mischwagen beziehungsweise aus dem Austrag im Stall ist kaum möglich und sinnvoll. Sie kann nur im ausgetragenen Futter repräsentativ praktiziert werden. Hierbei bietet sich zwangsläufig die frisch ausgetragene Mischung im Futtertrog an.
Mindestens drei Abschnitte des Futtermitteltroges, auf dem die Ration (Partie) ausgetragen werden soll, sollten als Probenahmestelle definiert werden. Durch seitliche Begrenzungswände (siehe Fotos) sollten repräsentative Fenster geschaffen werden. Diese sollten so dimensioniert werden, dass die Teilmenge der TMR-Mischung sich klar trennen lässt, das heißt die Barrieren nicht durch die Mischung überlagert werden.
Die Trennwände sollten frei stehend und kippsicher auf eine saubere PE-Folie gestellt werden. Die einzelnen Abstände können im Vorfeld definiert werden, um einerseits die Einzelprobenmenge einzustellen (mindestens 5 kg TMR-Frischmasse je Messpunkt, üblich zirka 50 cm Abstand der Abgrenzungswände) sowie gegebenenfalls gleichzeitig die Austragsgenauigkeit bewerten zu können.
Nachdem die Rinder vom Futtertisch abgesperrt wurden, um ein selektives Fressen der Mischung vor der Probenahme auszuschließen, wird die TMR durch den Mischwagen ausgetragen. Wenn ein Absperren der Tiere nicht möglich ist, sollten hinter den Messpunkten unter Umständen Personen stehen, welche den Zutritt der Tiere verhindern können.
Wenn das Futter ausgetragen ist, werden die PE-Folien mit den Begrenzungswänden aus dem Futtertrog herausgezogen. Die gesamte Futtermenge zwischen den Begrenzungen wird nunmehr als Einzelprobe definiert. Die Einzelproben der einzelnen Messpunkte werden durch intensives Durchmischen zu einer Sammelprobe vereint (empfohlene Menge der Sammelprobe mindestens 15 kg FM). Diese Sammelprobe wird durch geeignete Techniken (zum Beispiel Flächenausgrenzung durch Bildung von Diagonalen einer kreisförmig ausgebreiteten Sammelprobe, siehe Fotos) zu einer Endprobe reduziert (empfohlene Menge der Endprobe 1 bis 1,5 kg FM).
Die Endprobe
Die Endprobe ist in einen sauberen, dichten Plastikbeutel, aus welchem nach dem Einfüllen der Endprobe die Luft entfernt wird, zu verpacken und zu kennzeichnen. Um die Nährstoffverluste nach der Probenahme zu minimieren, müssen insbesondere Frischfutterproben, die einen TM-Gehalt von unter 80 % aufweisen, auf dem kürzesten Weg (maximal zwölf Stunden) zur Untersuchungsstelle gebracht werden. Direkter Einfluss von Luft, Sonnenlicht, erhöhten Temperaturen oder Kontakt mit verunreinigten Medien muss vermieden werden.
Sollte absehbar sein, dass ein Zeitraum von zwölf Stunden von der Probenahme bis zur Untersuchungsstelle überschritten wird, muss die Probe im Kühlschrank (maximal zwei Tage bei unter 8° C) zwischengelagert werden. Das Einfrieren von Futterproben (–18° C) bei einer Lagerdauer von über zwei Tagen ist grundsätzlich möglich, sollte aber auf ein Minimum beschränkt bleiben, da sensorische und nährstoffseitige Veränderungen, insbesondere in der Auftauphase, möglich sind.
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass TMR-Mischungen von geringer Aktualität sind, da sie nur für zwölf, maximal 24 Stunden repräsentativ sind und dann durch eine neue Partie ersetzt werden. Mikrobiologische Untersuchungen sind nach dem Einfrieren nicht mehr möglich, da sich durch den Prozess des Einfrierens die Ausgangskeimzahl verändert (zum Beispiel bei der Bestimmung des Hefegehaltes). Frische Futterproben sollten daher für mikrobiologische Untersuchungen unter Einhaltung der Kühlkette schnellsten zur Untersuchungsstelle transportiert werden.
Neben der gekennzeichneten Futterprobe müssen der unterschriebene Untersuchungsauftrag und ein aussagekräftiges Probenahmeprotokoll an die Untersuchungsstelle versandt werden, in welchem wichtige Informationen zur Probenahme und zur Probe selbst beschrieben werden sollten. Günstig wäre auch eine Beschreibung der Ration, um unter Umständen auf unerklärliche Befunde reagieren zu können. Diese Angaben können die Bewertung einer Futtermittelprobe durch die Untersuchungsstelle wesentlich verbessern. Zu allgemeinen Angaben können futterartspezifische Ergänzung hinzukommen.
Fazit
Nur mit einer fehlerfreien Probenahme und Probenbehandlung führt die Analyse zum richtigen Ergebnis.