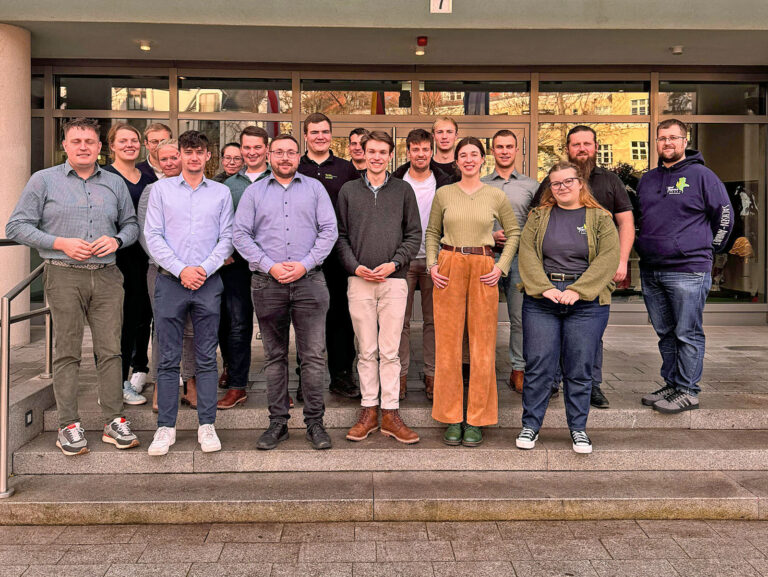„Zukunft ist eine innere Entscheidung“ mit diesem Zitat des Zukunftsforschers Matthias Horx starteten wir als Landesverband in das Jahr 2025, geprägt durch unterschiedliche Veranstaltungen des Vorjahres, in denen sich viele LandFrauen mit der Aufstellung ihrer Vereine und des LandFrauenverband für die Zukunft beschäftigt haben.
Umbruch und Veränderung sind unvermeidlich – Zukunft aber beginnt dort, wo wir uns bewusst dafür entscheiden, weiterzugehen. Ich habe mich in diesem Jahr bewusst dazu entschieden, mich noch einmal für die Wahl zur Präsidentin aufstellen zu lassen, weil ich einen festen Glauben daran habe, dass unsere LandFrauen-Gemeinschaft uns durch den Wandel tragen kann.
„Auch ich bin Gesellschaft“
Mir liegt es am Herzen deutlich zu machen, in welchen Strukturen wir arbeiten und seit mehr als 75 Jahren erfolgreich LandFrauenarbeit betrieben haben. Unsere 151 Ortsvereine bilden die Basis. Sie schaffen Gemeinschaft vor Ort, sind der soziale Kitt, wie es der Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) einmal so passend formuliert hat. Der Landesverband arbeitet auf einer anderen Ebene, macht seine Mitglieder durch Fortbildung und Qualifizierung stark. Wir schaffen und erhalten Netzwerke, wir horchen auf, mischen uns ein. Wir als Landesverband machen uns stark für die Frauen in Schleswig-Holstein. Und ja, wir sind die da oben, denn wir stehen oben in der Strukturpyramide. Und doch sind wir als Vorstand auch einfach nur LandFrauen, die sich ehrenamtlich engagieren.
Fotos (2): Meike von der Goltz
Unser Jahresmotto 2025 lautet „Auch in bin Gesellschaft – Zukunft ist unsere Entscheidung“ – dieser Slogan erinnert uns daran, dass jeder von uns eine Verantwortung trägt und dass die Gesellschaft nicht nur aus den großen Entscheidungen besteht, sondern aus den vielen kleinen, die wir tagtäglich treffen. Wir als LandFrauen sind nicht nur Teil dieser Gesellschaft, wir gestalten sie aktiv mit. Durch unser Engagement, unsere Fürsorge und unseren Einsatz leisten wir einen wertvollen Beitrag.
Anfang des Jahres nahm ich an der Bundesvorstandsitzung des dlv teil. In diesem Jahr gab es bei den Landesverbänden aus den sogenannten „neuen“ Bundesländern richtige Existenzängste, denn durch die Wahlen und dadurch neu aufgestellte Parteienverhältnisse sollen nun die Fördermittel, durch die die Frauenverbände in erheblichen Maßen finanziert sind, gestrichen werden. In dieser Diskussion wurde mir etwas einmal mehr bewusst, und ich möchte es gern mit auf den Weg geben: Es ist so wichtig, dass wir uns alle für die Stärkung unserer Demokratie einsetzen!
Aus dem Grund freue ich mich sehr auf ein neues Angebot in 2026 in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale SH. Wir werden Demokratielotsinnen qualifizieren. Denn jeder einzelne Schritt, der dazu führt, dass wir unsere Gemeinschaft stärken, ist wertvoll. Obgleich es stets eine Herausforderung darstellt, als rein mitgliedsbeitragsfinanzierter Verband zu agieren: selbst finanzierte Frauenpolitik zu haben ist in Zeiten, die auf uns zukommen, wichtiger denn je. Daher ist und bleibt es wichtig, dass wir alle als großer Verband von Ortsverein die Arbeit des Landesverbandes und des dlv unterstützen, weil wir mit unserem Netzwerk eine starker Multiplikator sind.
Zusammenhalt und Stärke
Wir LandFrauen sind eine starke Gemeinschaft. Ich bekomme das in meinem Kontext als Präsidentin sehr oft gespiegelt und möchte es an dieser Stelle gern weitergeben: die LandFrauen-Arbeit ist von unschätzbarem Wert und prägt das Leben auf vielen Ebenen. Es sind die Werte von Zusammenhalt und Stärke, die uns als LandFrauen immer wieder zusammenführen in unserem gemeinsamen Bestreben nach einer besseren Zukunft. Auch wenn die Welt um uns herum oft –und aktuell ganz besonders – von Unsicherheiten geprägt ist, können wir mit dem Wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können, eine stabile und lebenswerte Zukunft für uns und die kommende Generation schaffen! Lasst uns weiter ein starkes Netzwerk der Solidarität und des Engagements sein – für uns, unsere Familien und für die Zukunft der ländlichen Gemeinschaften. WIR, unsere Gemeinschaft – mir gibt das ein positives, zuversichtliches Gefühl!
Und ich möchte uns allen mit auf den Weg geben: Lasst uns stets achtsam miteinander umgehen, lasst uns immer wieder positive Ziele setzen, und uns in unserem Tun und Handeln bestärken! Mit den Worten der Pilotin Amelia Earhart, die als erste Frau den Atlantik überflogen hat, möchte ich uns alle zum Handeln für unsere demokratische Gemeinschaft auffordern. Die effektivste Art, es zu tun, ist, es zu tun! Gemeinsam sind wir die Gesellschaft, und gemeinsam entscheiden wir über unsere Zukunft! In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein anpackendes, zuversichtliches Jahr 2026.
Vizepräsidentin
Sylke Messer-Radtke:
Begeisterung und Verantwortung
Meinen Jahresrückblick auf das Jahr 2025 schreibe ich mit einem vollen LandFrauen-Herzen und den Nachwirkungen einer tollen 75igsten Jubiläumsfeier. Auf dem Jubiläum wurde deutlich, was unsere gemeinsame LandFrauen-Arbeit ausmacht, Begeisterungsfähigkeit und Verantwortungsbereitschaft für die Frauen im ländlichen Raum.
Wenn Frauen es schaffen, in siebeneinhalb Jahrzehnten abwechslungsreiche Programme und starke Vereinsvorstände zu stellen, sind wir ein Sprachrohr für Frauen und Familien im ländlichen Raum und können zuversichtlich in die Zukunft gehen.
Bereichernde Aufgaben
Die Einladung zu den unterschiedlichsten Veranstaltungen in den örtlichen LandFrauenvereinen ist eine der bereicherndsten Aufgaben für mich als Vizepräsidentin. Besonders gern bin ich in diesem Jahr nach Pellworm gefahren. LandFrauenarbeit auf unseren Inseln ist nochmal eine andere Herausforderung, einerseits ist man unter sich, aber andererseits verhindert die Insellage den Austausch mit anderen LandFrauen. Ich war begeistert von der schwungvollen Jahreshauptversammlung der Insel-LandFrauen und nebenbei einmal tatsächlich zu erleben, was es heißt, mit den vielen Gänsen vor der Haustür zu leben und zu arbeiten, war auch sehr erhellend.
Alle zwei Jahre findet der Hauswirtschafts-Kongress statt, diesmal in Köln, und ich konnte dabei sehen, wie sich die aktive Hauswirtschafts-Community mit dem Thema „Hauswirtschaft – Zukunft – Transformation“ auseinandersetzt. In dem Forum mit dem Thema „Wandel in den Köpfen und Töpfen. Die Kopenhagener Ernährungsstrategie“, wurde eindrucksvoll geschildert, wie unsere dänischen Nachbarn das Thema Gemeinschaftsversorgung in Schulen angehen, und dabei regionale und Bio-Lebensmittel einsetzen.
Digitale Patin
Im Juni gab es eine weitere tolle Veranstaltung, bei der unsere pragmatische LandFrauenarbeit für ein breites Publikum sichtbar wurde. Gemeinsam mit dem Breitbandkompetenzzentrum SH, in Person von Maxim Schmuck, durften wir auf dem Tech-Festival der Körber Stiftung in Hamburg unsere Kooperation der Digitalen Patin vorstellen. Große Bühne, viele Scheinwerfer, verkabelt mit dem Mikrofon und nicht so ganz genau wissen, ob das Gegenüber bei den vorbereiteten Fragen bleibt, war es eine tolle Erfahrung. Unser Projekt wurde als einfach, niedrigschwellig, praktikabel gelobt und auch die Kooperation aus dem Ehrenamt und der Hauptamtlichkeit des BKZ wurde erstaunt wahrgenommen. Die Digitale Patin durfte sich auch bei der „Digitalen Woche” in Kiel vorstellen und mit Unterstützung der Aukruger LandFrauen wurde dieser Termin mit Leben gefüllt. Zum Netzwerktreffen der Digitalen Patin im September konnte der neue Imagefilm, der mit Unterstützung von Mitteln des Kieler Landwirtschaftsministeriums erstellt wurde, vorgestellt werden und ist auf der Homepage des LandFrauenverbandes einzusehen.
Lebendige Dörfer
Viel Zeit hat für mich in diesem Jahr die Juryarbeit eingenommen. Als erstes stand „Unser Dorf mit Zukunft” im Jahresplan und wir haben uns sehr über die vielen Bewerbungen gefreut. Mit Unterstützung von Julia Kortum hat sich die Akademie für die ländlichen Räume an neue Bewerbungskriterien gewagt und damit die Dörfer angesprochen und uns die Juryarbeit erleichtert. Zur Auftaktveranstaltung in Bordesholm konnten 38 Dörfer eingeladen werden. 31 Bewerber nutzten die Plattform, sich kurz vorzustellen und untereinander auszutauschen mit großer Begeisterung. Ende Juni war es dann so weit, und die zehn nominierten Dörfer wurden an drei Tagen bereist. Ich teile mir die Aufgabe mit unserer Präsidentin Claudia Jürgensen und wir waren hellauf begeistert von den tollen Dorf-Vorstellungen und den innovativen Lösungen vor Ort im ländlichen Raum und die Einbindung der Dorfgemeinschaften in unterschiedlichsten Formen. Das Siegerdorf Osterby hat dann im Oktober eine würdige Siegesfeier ausgerichtet, bei der unsere Präsidentin die Laudatio auf das zweitplatzierte Dorf halten durfte – „Loop, klein aber fein”.
Als zweites war in diesem Jahr der Nachhaltigkeitspreis des Landes Schleswig-Holstein dran. Ausrichter ist hier das Umweltministerium und es gab sagenhafte 68 Bewerbungen. Hierbei unterstützte unsere Geschäftsführerin Dr. Gaby Brüssow-Harfmann und wir waren gut beschäftigt, die zahlreichen und auch fachlich so unterschiedlichen Bewerbungen rund um den Nachhaltigkeitsgedanken in ein Ranking zu bringen. Gemeinsam sind wir stark und haben auch hier unseren Blick aus der Frauen- und Familiensicht auf die soziale Nachhaltigkeit, die Umweltbildung und den Klimaschutz auf die Bewerbungen gerichtet. Die Preisträger wurden bei der IB.SH-Bank in Kiel geehrt und damit war meine Juryarbeit für den LandFrauenverband in diesem Jahr erledigt.
Weite Wege brücksichtigen
Des Weiteren haben mich in diesem Jahr zahlreiche Termine in Molfsee beschäftigt, unser AK Archiv Molfsee hat seine Treffen abgehalten und wir haben uns beim LandFrauentag und beim Erinnerungs-Nachmittag zu den aktuellen Museumsthemen berichtet. Ich habe noch zahlreiche weitere Termine im Freilichtmuseum Molfsee wahrgenommen, um die gute Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen zu untermauern. Unterstützung haben wir auch den Kreisverbänden Dithmarschen und Nordfriesland zukommen lassen, die sich für den Erhalt der Perinatalzentren Level 1 der Kliniken in Heide, Flensburg und Itzehoe eingesetzt haben. Eine für uns nicht zu verstehende Entwicklung in der Krankenhausversorgung in der Fläche, wobei die Wege, die wir zurücklegen müssen, keine Bewertung finden. Wir werden auch im kommenden Jahr nicht müde werden, uns für die Frauenthemen einzusetzen und ich freue mich schon auf die im Kalender notierten Termine in den LandFrauen-Ortsvereinen.
Präsidiumsmitglied Lena Haase:
mehr positives Flair
Wieder liegt ein buntes LandFrauenjahr 2025 hinter uns und wir blicken gespannt ins neue Jahr 2026. Dieses Jahr startete, als was es ist – ein Jahr der Jubiläen in unseren LandFrauenvereinen und Verbänden.
Erfolgreicher Dialog
Wir haben als Vorstand vielerorts mitgefeiert. Immer im Austausch untereinander und mit anderen Verbänden und Institutionen lernen wir viel Neues, erfahren von der Wertschätzung, die uns LandFrauen entgegengebracht wird und vernetzen uns stetig weiter. Im April konnten wir den Dialogprozess des Kieler Landwirtschaftsministeriums abschließen. Nach Ulrike Röhr durfte ich mit unserer Präsidentin Claudia Jürgensen an diesem Prozess mitwirken, und das hat wirklich viel Spaß gemacht.
Wertvoll ist auch die Ausschussarbeit bei uns im Landesverband oder auch im Bundesverband. Aus diesen sind immer wieder wichtige Positionspapiere und eine Kampagne gegen die Altersarmut von Frauen hervorgegangen. Unser „LandFrauenTag“ war wieder ein riesiger Blumenstrauß aus tollen Frauen, munteren Gesprächen, gutem Input, schöner Musik, guter Unterhaltung und so vielen kreativen und informativen Ständen. Wir haben die Holstenhallen mit so viel positivem Flair gefüllt – davon immer gerne mehr.
Auch die diesjährige Norla konnte daran anschließen, mit neuen Ideen diente unser Pavillon als Raum für guten Austausch und als Bühne für einige unserer Partner.
Pinktober
In diesem Jahr war nicht nur Frauenpolitik mein persönliches LandFrauenthema, sondern auch der Pinktober – natürlich hat auch dieser 2025 ein Jubiläum gefeiert – seinen 40. Jahrestag – immer mit dem Motto „Gib auf dich Acht“. Es fanden vielerorts Veranstaltungen statt – in Heide tauchte ein großes Team um Inken Stoffmehl die ganze Stadt in Pink und pinke BHs. In Kiel haben Claudia Jürgensen, Ninette Lüneberg, Iris Christensen und ich am „Pink-Run“ der sehr engagierten Kieler Brustkrebssprotten teilgenommen. Diese engagierten Frauen sind Mutmacherinnen.
Mit dieser positiven Energie im Gepäck starte ich in ein neues Jahr. Ich wünsche Ihnen allen das Beste fürs neue Jahr und die Power sich zu engagieren für ihr und euer Herzensthema.
Präsidiumsmitglied Heidi Thamsen:
wir werden gehört
Das vergangene Jahr war geprägt von vielfältigem Engagement, zahlreichen Begegnungen und wichtigen Impulsen für die Zukunft der LandFrauenarbeit.
Frauen sozial absichern
Nach längerer Pause nahm der Facharbeitskreis Agrar- und Umweltpolitik, ländliche Räume seine Arbeit wieder auf. Als Vorsitzende des Fachausschusses in Zusammenarbeit mit Anette Störtenbecker, Bildungsreferentin Agrarwirtschaft, konnten mit engagierten Teilnehmerinnen aus den Kreisen zentrale Themen neu belebt werden – insbesondere die soziale Absicherung der Frauen in landwirtschaftlichen Betrieben sowie deren Sichtbarkeit innerhalb der Branche und Gesellschaft.
Die Teilnahme an der Informationsveranstaltung zur Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) bot aktuelle Einblicke in agrarpolitische Entwicklungen. Die Einladung zum parlamentarischen Abend in das Landeshaus war ein weiteres Highlight für alle anwesenden LandFrauen. In allen Ansprachen kam die Wertschätzung der LandFrauen deutlich zum Tragen. Wir LandFrauen werden gehört und bekleiden eine positive Reputation im Land.
Verbundenheit gestärkt
Ein besonderer Schwerpunkt lag in der Mitarbeit im Facharbeitskreis Einkommenskombination, in dem praxisnahe Perspektiven der landwirtschaftlichen Betriebe eingebracht werden konnten. Hier stellt sich immer wieder heraus, wie sich Frauen auf den Höfen etablieren und ihren eigenen Geschäftszweig entwickeln können. Hervorzuheben war das Netzwerktreffen der Unternehmerinnen, das durch den Besuch eines landwirtschaftlichen Betriebes einer engagierten jungen Landwirtin bereichert wurde. Die Gespräche und Einblicke vor Ort sowie das Netzwerken und die Fachvorträge stärkten die Verbundenheit und Motivation der teilnehmenden Frauen.
Vorfreude auf 2026
In diesem Zusammenhang wächst auch die Vorfreude auf das für 2026 geplante Forum für Frauen in der Landwirtschaft, das wichtige Impulse und Austausch auf Landesebene verspricht. Hier wird es ein breites Angebot für alle Themen rund um die Frauen in der Landwirtschaft geben. Angesprochen sind alle Frauen, die mit dem landwirtschaftlichen Sektor in Berührung kommen. Dieses sind Betriebsleiterinnen genauso wie Ehefrauen, Mitarbeiterinnen und alle die sich der Landwirtschaft verbunden fühlen.
Im Laufe des vergangenen Jahres erfolgten zahlreiche Besuche von Jubiläen und Jahreshauptver-sammlungen der LandFrauenvereine auf Orts- und Kreisebene, die die Vielfalt und Stärke der LandFrauenarbeit in den Regionen erneut sichtbar machten. Darüber hinaus erfolgte eine engagierte Begleitung von Seminaren, welche die Weiterbildung und persönliche Entwicklung der Mitglieder unterstützen. Molfsee feierte im Juni sein 60jähriges Jubiläum. Hier bot sich mir die Gelegenheit, Kontakte zu pflegen und die Bedeutung der LandFrauen im kulturellen und gesellschaftlichen Bereich hervorzuheben.
Bewährtes und Neues
Ein besonderes Augenmerk lag auf dem Messeauftritt bei der Norla. Der LandFrauenpavillon präsentierte sich in einem neuen Erscheinungsbild, das sowohl Bewährtes als auch neue Angebote vereinte. Die vielfältigen Aktionen und Gespräche verdeutlichten erneut die zentrale Rolle der LandFrauen im ländlichen Raum. Eine Vielzahl von Veranstaltungen sowie Facharbeitskreisen und Besuche auf Orts- und Kreisebene lassen mich wertschätzend zurückblicken auf ein ereignisreiches Jahr 2025. Mit dieser angenehmen Erfahrung blicke ich optimistisch und zuversichtlich auf das Jahr 2026 und freue mich auf viele interessante Begegnun-gen und Gespräche mit LandFrauen und allen Gremien, in denen ich mitwirken darf.