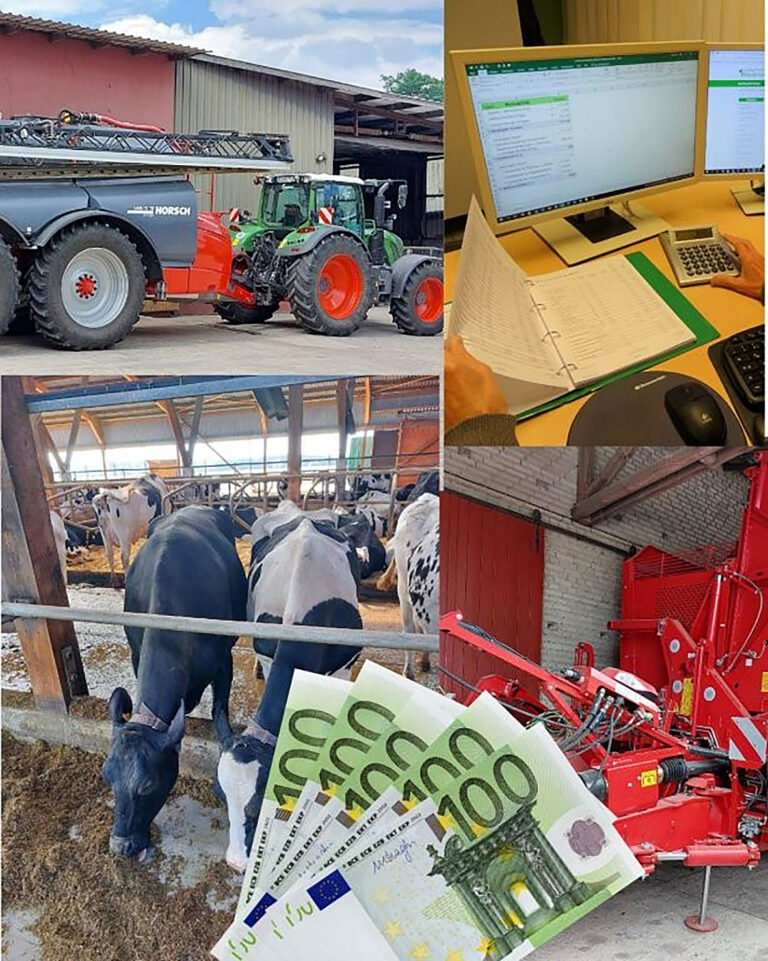Die Land-Grazien aus Schleswig-Holstein haben sich einer besonderen Mission verschrieben: Frauen und Kindern, die häusliche Gewalt erfahren, Schutz, Unterstützung und neue Perspektiven zu bieten. Was einst als kleine Initiative engagierter Frauen begann, ist heute ein starkes Netzwerk aus Mut, Empathie und praktischer Hilfe. Im Interview mit den LandFrauen spricht Miriam Peters, Begründerin der Land-Grazien, über ihre Arbeit, die Herausforderungen in ländlichen Regionen und darüber, warum es so schwierig ist, das Schweigen zu brechen und Betroffenen eine Stimme zu geben.
Miriam Peters, wie ist der Verein Land-Grazien entstanden und was steckt hinter dem Namen?
Miriam Peters: Die Land-Grazien sind ein Projekt des Vereins Frauen helfen Frauen Sandesneben und Umgebung e. V., der im Februar 2020 gegründet wurde. Er verfolgt das Ziel, sich aktiv gegen Gewalt an Frauen und Kindern einzusetzen.Ich habe einige Zeit in einem Frauenhaus gearbeitet und Soziale Arbeit studiert. Zu Hause, auf dem Dorf, wurde mir bewusst, dass es für die Betroffenen hier nahezu unmöglich ist, Unterstützung zu bekommen. Daraufhin habe ich mir überlegt, wo genau die Herausforderungen liegen und wie man sie angehen könnte. Deswegen habe ich die Land-Grazien ins Leben gerufen.
Welche Angebote stellt ihr für Frauen und Kinder konkret zur Verfügung?
Wir bieten ganz niedrigschwellig Beratung und Begleitung an, wenn eine gewaltbetroffene Frau sich bei uns meldet. Wir zeigen Lösungswege aus gewaltvollen Partnerschaften auf, unterstützen bei Anträgen, begleiten zum Beispiel zur Polizei oder zur Spurensicherung, nutzen unser Netzwerk für weitere Unterstützungsangebote.
Foto: Meike von der Goltz
Seit Mitte des Jahres gibt es außerdem die Land-Grazien Girls, die sich auf die Zielgruppe der 13-18-jährigen Mädchen konzentrieren.
Auf Social Media machen wir Content zu Gewaltprävention und Empowerment. Dort haben wir mittlerweile eine große Reichweite von über 23.000 Followern und ein sehr stabiles Netzwerk, in dem auch sehr große Influencer und Influencerinnen sind, die uns regelmäßig unterstützen. So erreichen wir wirklich viele potenziell betroffene Frauen.
Wie sieht ein typischer Tag bei den Land-Grazien aus?
Bei uns gibt es keine typischen Tage. Jeder Tag kann alles werden: super entspannt und ruhig, völliges Chaos und lauter spontane Termine – oder eben irgendetwas dazwischen. Planung ist immer gut und schön, aber wir haben uns abgewöhnt, uns darauf zu verlassen. Die Frauen und Kinder gehen immer vor und Krisen können schlecht geplant werden. Die Frauen melden sich und dann sind wir da. Manchmal heißt es dann fürs ganze Team: „Alles stehen und liegen lassen, wir haben etwas zu organisieren!”
Das ist aber auch genau das, was wir alle irgendwie lieben. Langweilig wird es bei uns nie und wir alle sind mit Herzblut dabei.
Welche gesellschaftlichen Strukturen oder Muster begünstigen häusliche Gewalt?
Traditionelle Rollenbilder sind ein großer Faktor: Er bringt das Geld heim, sie ist zu Hause. Das bringt die Frauen in eine gefährliche finanzielle Abhängigkeit und lässt ein großes Machtgefälle entstehen. Wenn er dann gewalttätig wird, hat sie große Schwierigkeiten, „einfach” zu gehen. Oft haben die Frauen, die sich bei uns melden, gar kein eigenes Konto.
In solchen Beziehungen schwingt ja auch oft mit, dass er „das Sagen hat“. Das spielt eben auch in das Machtgefälle hinein und erschwert es der Frau zu erkennen, dass dieses Gefüge nicht „normal” ist.
Wie verändert sich das Thema in ländlichen Regionen im Vergleich zu Städten?
In ländlichen Räumen gibt es schlichtweg kaum Beratungsangebote für Betroffene. Um Unterstützung zu bekommen, müssen oft sehr lange Strecken bewältigt werden. Mit dem kaum vorhandenen ÖPNV auf dem Dorf ist das eine Zumutung. Zwar haben viele Frauen in ländlichen Räumen ein Auto, aber oftmals werden sie digital überwacht und geortet. Oder der Fahrtweg zur nächsten Beratungsstelle in einer Stadt ist zu lang. Dazu kommen die oft sehr begrenzten Öffnungszeiten der meisten Beratungsstellen. Spontan und zeitnah einen Termin zu bekommen, ist furchtbar schwierig bis unmöglich.
Auch die sozialen Gefüge auf dem Dorf sind anders als in der Stadt. Jeder kennt jeden, man war zusammen in der Schule und spielt gemeinsam Fußball. Dass die Leute dann zum Täter halten, weil der doch „so nett ist“ und man sich schon so lange kennt, ist keine Seltenheit. Für Betroffene bedeutet das in aller Regel eine Isolierung. Sie trauen sich höchstwahrscheinlich gar nicht, etwas zu sagen, weil sie den Kürzeren ziehen werden.
Welche Rolle spielen Tabuisierungen und Schweigen im Umfeld der Betroffenen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn Schweigen, obwohl man alles mitbekommt, signalisiert der Betroffenen, dass das, was ihr angetan wird, nicht wichtig genug ist. Sie erfährt keine Solidarität, keinen Rückhalt und wird daraus lernen, erst recht nichts mehr zu sagen. Dasselbe gilt für Tabuisierungen. „Darüber spricht man nicht“, hören wir sehr oft und wir sagen: „Ganz im Gegenteil! Sprecht über häusliche Gewalt, damit Täter wissen, dass ihr Verhalten nicht hingenommen wird und Betroffene sich trauen, den nächsten Schritt zu gehen.“
Welche präventiven Maßnahmen setzt ihr, um Gewalt gar nicht erst entstehen zu lassen?
Zum einen posten wir auf Instagram regelmäßig Content, der aufklärt. Also: Was ist überhaupt Gewalt, wie kann sie aussehen? Gleichzeitig versuchen wir, unsere Followerinnen zu stärken, ihnen Mut zu machen. Im besten Fall erkennen sie problematische Muster so schneller und fühlen sich empowert, sich dagegenzustellen.
Zum anderen halten wir immer öfter auch Vorträge oder veranstalten Workshops.
Das Wichtige ist, dass das Thema präsent bleibt, denn die Tabuisierung bewirkt nur, dass niemand sich traut, etwas zu sagen.
Wie erreicht ihr Kinder und Jugendliche, um sie für dieses Thema zu sensibilisieren?
Unser Trägerverein veranstaltet in regelmäßigen Abständen Aktionen für Kids. Das können sportliche Selbstbehauptungs-Angebote sein. Aber auch unsere Happy Days, die schon zweimal stattgefunden haben, sind eine tolle Gelegenheit, Selbstwirksamkeit zu spüren. Die Happy Days sind ein Festival für und von Kids, bei dem die Kinder und Jugendlichen von Anfang an alles planen und bestimmen. Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung führen zu Selbstbewusstsein, und das ist ein wichtiger Faktor bei häuslicher Gewalt.
Unser neues Projekt Land-Grazien Girls spricht konkret junge Mädchen an, die in ihrer ersten Beziehung Gewalt erleben. Bei sehr jungen Mädchen kann sich das tatsächlich anders zeigen als bei erwachsenen Frauen, daher ist es wichtig, hierauf einen gesonderten Blick zu haben.
Wie können Frauen und Kinder, die betroffen sind, Hilfe bei euch finden?
Die Betroffenen können sich über Social Media, E-Mail oder Telefon bei uns melden, außerdem gibt es auf unserer Webseite ein gesichertes Online-Formular. Im Kreis Herzogtum Lauenburg bieten wir außerdem auch persönliche Beratung an. Wir haben einen umgebauten Handwerkerbus, der von außen aussieht wie ein Firmenauto, innen drin aber ein Büro hat. Mit diesem Beratungsmobil können wir die Frauen dort treffen, wo sie sich sicher fühlen und im Alltag aufhalten. Das kann ein wichtiger Punkt sein, wenn die Frau von ihrem Partner überwacht wird. Sie kann dann nicht einfach in die nächste Stadt zur Beratungsstelle fahren, sondern nur dorthin, wo er keinen Verdacht schöpft.
Welche Hürden erleben Betroffene am häufigsten, wenn sie Hilfe brauchen?
Leider wird Betroffenen oft schlichtweg nicht geglaubt. Und das kann fatal sein, denn so verlieren die Frauen verständlicherweise schnell das Vertrauen in die Instanz, an die sie sich gewendet haben. Oder sogar ganz allgemein: Sie erzählen nie wieder was.
Manchmal sind es auch bürokratische Hürden, die Betroffenen das Leben erschweren. Es dauert einfach zu lange, bis etwas passiert, bis Sanktionen durchgesetzt werden. In der Zwischenzeit kann furchtbar viel passieren.
Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit Polizei, Justiz und Sozialdiensten?
Die Zusammenarbeit ist für uns von sehr großer Bedeutung, da es ein sehr gutes Netzwerk benötigt, um möglichst gute Ergebnisse und gesamtheitliche Lösungen für die Betroffenen zu schaffen. Daher arbeiten wir sehr eng mit den unterschiedlichen Akteuren von Polizei, Gericht und Ämtern zusammen.
Was wünscht ihr euch von der Politik, um eure Arbeit langfristig zu stärken?
Wir wünschen uns von der Politik, dass die Istanbul-Konvention wirklich konsequent umgesetzt wird. Sie verpflichtet ja dazu, Gewalt gegen Frauen zu verhindern, Betroffene zu schützen und Täter zur Verantwortung zu ziehen. In der Praxis heißt das: genug finanzierte Schutz- und Beratungsstellen, mehr Präventionsarbeit, gut geschulte Fachkräfte bei Polizei und Justiz und eine klare politische Verantwortung. Es reicht nicht, die Konvention nur zu unterschreiben. Sie muss im Alltag spürbar werden, damit Frauen und Kinder wirklich sicher sind.
Wie kann jede/-r Einzelne im Alltag Betroffene unterstützen oder aufmerksam machen?
Das Wichtigste ist: Niemals Druck ausüben. Sätze wie „Warum gehst du nicht einfach?” oder „Ich hätte mich längst getrennt, warum lässt du das mit dir machen?” sind weder hilfreich noch geben sie der Betroffenen das Gefühl, gehört zu werden. Ganz im Gegenteil, sie wird sich wahrscheinlich abwenden, weil sie sich verurteilt fühlt.
Zuhören und immer wieder signalisieren, dass man da ist, Hilfestellungen im Alltag anbieten – zum Beispiel auf die Kinder aufpassen, während die Betroffene sich beraten lässt – und Ähnliches, das sind Unterstützungen, die wirklich zielführend sind.
Und natürlich unbedingt von uns erzählen. Es gibt Betroffene, die zögern, sich beraten zu lassen, weil es so aufwendig ist. Wir versuchen, alles komplett niedrigschwellig zu halten. Keine, die sich bei uns meldet, verpflichtet sich zu irgendetwas. Vielleicht macht es das einigen Menschen leichter, sich Unterstützung zu holen.
Wie kann man euren Verein unterstützen?
Spenden sind unglaublich wichtig für uns, da wir keine öffentlichen Gelder bekommen beziehungsweise bekommen möchten. Wir sind gern unabhängig und frei in unserer Arbeit, daher finanzieren wir uns über Stiftungsgelder sowie Spenden.
Ansonsten wünschen wir uns, dass die Menschen von uns erzählen, damit möglichst viele gewaltbetroffene Frauen wissen, dass es uns gibt und sie bei uns Unterstützung bekommen können.
Info
Einmal im Monat stellen wir ab jetzt an dieser Stelle unsere Kooperationspartner vor, die mit uns LandFrauen für Gemeinschaft, Stärke und Zusammenhalt auf dem Land stehen.