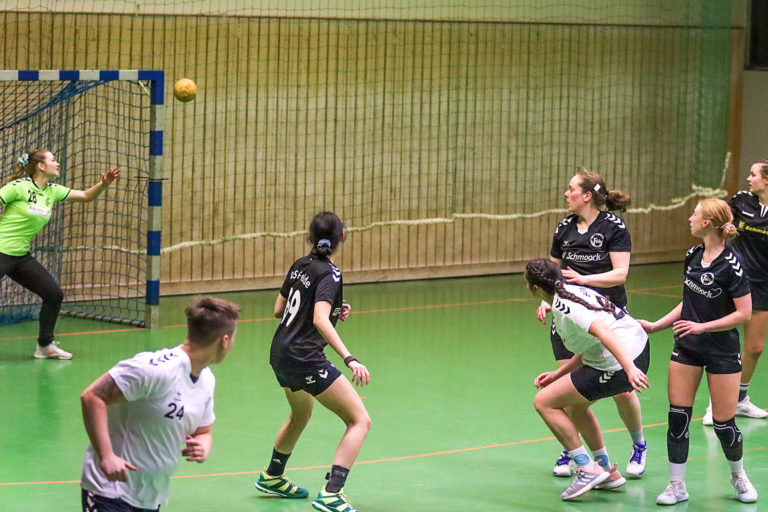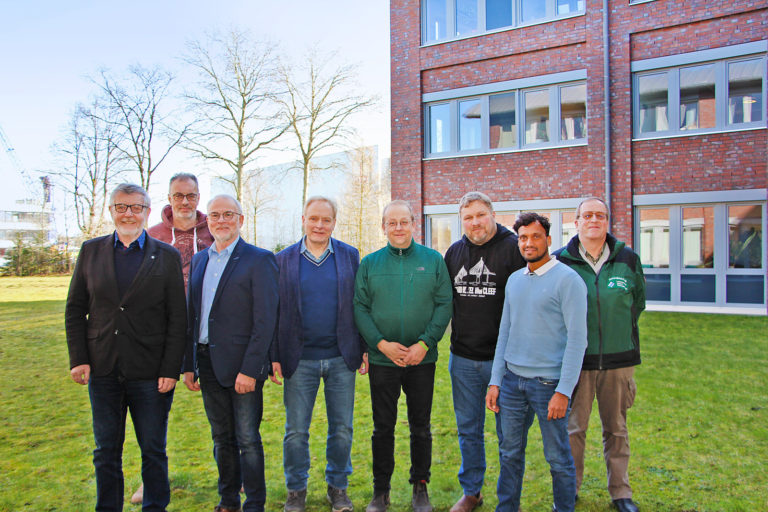Leuchtende Blütenstände im Frühjahr, beeindruckend große Blätter und bestechend schöne Herbstfärbung sind die Merkmale des stattlichen und winterharten Schildblatts (Darmera peltata). Die feuchtigkeitsliebende Blattschmuckstaude zieht von Frühjahr bis Herbst die Blicke auf sich. In England und Holland ist die Schönheit häufig in Parks und Gärten zu sehen. Wer ihre Bedürfnisse kennt, kann sich auch hierzulande an der auffälligen Schönheit erfreuen.
Bei der Neupflanzung rechnet man zwei bis maximal drei Exemplare pro Quadratmeter. Sie bilden schnell eine dichte, ansehnliche Gruppe, die tropisches Flair im Garten verbreitet. Die imposanten Blätter erreichen bei voller Größe einen Durchmesser von etwa 60 cm und wachsen dabei 50 bis 100 cm hoch. Für eine gute Entwicklung sind die Stauden auf dauerfeuchten und nährstoffreichen Boden angewiesen. Ein Platz am Teichrand, am Bachlauf oder in einer feuchten Senke mit lehmigem Boden ist perfekt geeignet. Hin und wieder mal ein paar Zentimeter tief im Wasser zu stehen, macht dem Schildblatt nichts aus. Sandboden eignet sich aufgrund der geringen Wasserhaltefähigkeit nicht so gut. Manche Hauseigentümer leiten inzwischen das Regenwasser nicht mehr in den Kanal, sondern lassen es über eine Rigole auf dem Grundstück versickern. Auch ein solcher Standort bietet sich für das Schildblatt an. Bei einer Pflanzung ohne direkte Wasserversorgung aus Bach oder Teich muss die Staude regelmäßig ausreichend gegossen werden.
Die Vorliebe für sonnige bis halbschattige Standorte beeinflusst die Wahl der Pflanzpartner. Teichsimse (Schoenoplectus lacustris), Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus), Blutweiderich (Lythrum salicaria), Wasserdost (Eupatorium) und Mädesüß (Filipendula ulmaria) bilden einen hübschen Kontrast zu den riesigen Blatttellern. Empfehlenswert ist zudem die Kombination mit dem 80 bis 120 cm hohen Kerzen-Greiskraut (Ligularia przewalskii), das von Juli bis September mit gelben Blütenkerzen das Beet verschönert. Pracht-Storchschnabel ‚Rosemoor‘ (Geranium x magnificum) und die dekorative Sumpf-Wolfsmilch (Euphorbia palustris) vervollständigen das Quartett.
Im April und Mai schieben sich die 50 bis 70 cm hohen, laublosen Blütenstände aus dem Boden. Sie sind von einem doldenartigen Blütenstand gekrönt, der aus vielen Einzelblüten besteht. Der Flor ähnelt dem der Bergenien, denn die hellrosafarbenen Kronblätter kontrastieren schön mit der pinkfarbenen Blütenmitte. Die frühe Blüte kann allerdings von Spätfrösten in Mitleidenschaft gezogen werden. Bei Bedarf sollte man entsprechende Schutzmaßnahmen ergreifen. Aus den Samenständen entwickeln sich Kapselfrüchte, die winzige Samen enthalten. Die Anzucht daraus ist sehr aufwendig, da die Lichtkeimer einen Wechsel von hohen und niedrigen Temperaturen während der langen Keimphase benötigen. Viel geschickter ist es, die Ausbreitung dem kräftigen Rhizom zu überlassen. Die abgeflachten Rhizome wachsen normalerweise unterirdisch, schieben sich aber auch schon mal über Steine oder breiten sich direkt auf der Erdoberfläche aus. Wer verhindern möchte, dass das Schildblatt seine Nachbarn überwuchert, setzt den Wurzelballen am Teichrand beispielsweise in einen Wasserpflanzenkorb, der dreimal so groß ist wie der Wurzelballen. Alternativ übernimmt eine bis 50 cm tief in den Boden senkrecht eingearbeitete Rhizomsperre die gleiche Funktion.
Während der Blüte treiben die Blätter des Schildblatts aus und entfalten sich. Am optimalen Standort erweist sich die Staude als sehr wüchsig. Die schön geformten Blätter punkten im Herbst mit einer intensiven Blattfärbung. Sie verläuft von Gelb über Orange bis hin zu einem leuchtenden Rotbraun. Das abgestorbene Laub verbleibt möglichst an der Pflanze. Zum einen dient es so manchem Gartenbewohner als Unterschlupf für den Winter, zum anderen bildet es eine natürliche Decke für die Rhizome. Sie überstehen selbst Temperaturen von –20 °C unbeschadet. Beim Frühjahrsputz im Garten räumt man im März die Laubreste weg. Tipp: Die klein bleibende Sorte ‚Nana‘ eignet sich perfekt für große Gefäße mit Wasserspeicher. Den Füllstand hält man immer auf dem Maximum. Alle zwei Jahre sollte man die Pflanze aus dem Gefäß nehmen und das Rhizom zurückschneiden. Den Winter über kommt der Topf am besten ins helle und kühle Winterquartier. ‚Nana‘ eignet sich zudem für alle Gartenecken, die über ein weniger großzügiges Platzangebot verfügen, da die Pflanze mit 50 cm Höhe deutlich niedriger bleibt als die Art.
Ursprünglich stammt das Schildblatt aus den Wäldern und von den Flussufern Oregons und Kaliforniens. Manchmal wird die dekorative Blattschmuckpflanze auch als Indianerrhabarber oder Regenschirmpflanze bezeichnet. Auf Wanderungen durch Großbritannien und Irland findet man die Staude auch an Bach- und Flussufern, denn dort ist sie inzwischen eingebürgert. Wie Bergenien (Bergenia) und Purpurglöckchen (Heuchera) zählt die Staude zu den Steinbrechgewächsen.