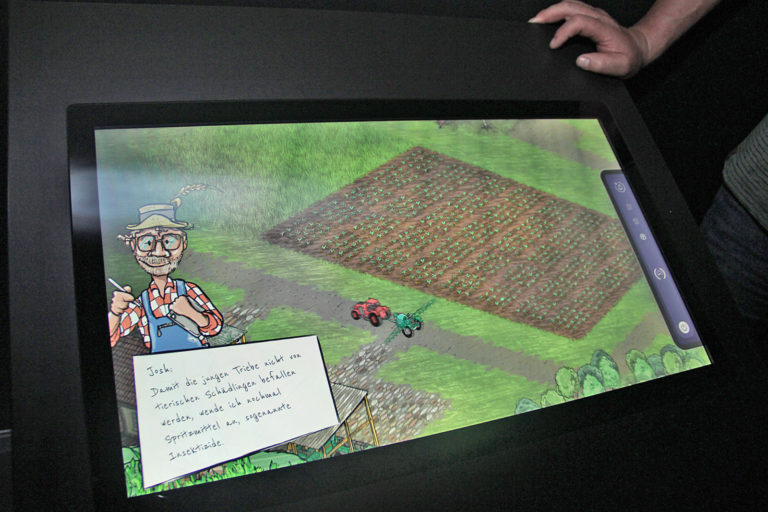Im Landkreis Sonneberg in Thüringen wurde zum ersten Mal in Deutschland ein AfD-Kandidat zum Landrat gewählt. Es war eine korrekte demokratische Wahl. Dadurch unterscheidet sie sich von Scheinwahlen in so manchen Ländern der Erde, von gefälschten, erzwungenen oder bedrohten Wahlen, von Wahlen, die der unterlegene Gegner nicht anerkennt, von Wahlen in Ländern, in denen eine Opposition, bevor sie überhaupt antreten kann, mundtot gemacht, verfolgt und ins Gefängnis gesteckt wird.
Die AfD in Thüringen konnte gewählt werden, obwohl sie der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft hat und beobachtet. Sie kann gewählt werden, obwohl führende Mitglieder unseren Staat verachten, verhöhnen oder gar nicht anerkennen. Den Staat, der es ihnen ermöglicht, gewählt zu werden. Die Partei, die am lautesten schreit, dass sie nicht sagen dürfe, was sie denkt, sagt beständig, was sie denkt, und ihr Kandidat wurde deswegen gewählt – oder trotzdem.
Die Frage ist nur, warum.
Die AfD ist einerseits sichtbar durch allgemeine, inhaltsarme Parolen, die jeder verstehen kann, wie er will: „Deutschland, aber normal“, „Für deutsche Leitkultur“ und „Wir sagen, was ihr denkt“ – oder durch einfach gestrickte allgemeine Forderungen – gegen Zuwanderung, gegen Gendern, aber auch gegen die EU und gegen den Euro.
Aber vielleicht ist das auch vielen an der Wahlurne egal. Die Vermutung liegt nahe, dass ein Teil der hohen Ergebnisse der AfD sich nicht aus Zustimmung zu ihren Inhalten speist, sondern sogenannte Proteststimmen sind – aus Empörung über die „Altparteien“, um es ihnen mal zu zeigen. „Sie haben uns belogen und betrogen, sie nutzen uns aus, und zumindest machen sie alles falsch“, so die Meinung.
Wählt man dann Leute, die keinen wirklichen Plan haben, wie das gehen soll in unserer komplexen Gesellschaft, vielleicht noch nicht einmal ein Interesse? Eine kleine Episode auf kommunaler Ebene: Die AfD hat es nicht vermocht oder für nötig gehalten, ihren Sitz in acht von zehn Kieler Ortsbeiräten zu besetzen, wie die „Kieler Nachrichten“ vermeldeten, und zwar eine ganze Legislaturperiode lang. Dadurch habe sogar manchmal die Beschlussfähigkeit gelitten. Wenn dies nicht geradezu Verachtung des parlamentarischen Systems ist, so doch mindestens Gleichgültigkeit gegenüber gemeinschaftlichen Aufgaben.
Protestwahl ist Schuldzuweisung. Die feiert leider auch in den anderen parlamentarischen Parteien fröhliche Urständ. „Die Ampel ist schuld, dass die AfD zulegt.“ – „Nein, die Opposition hat die öffentliche Meinung zu deren Vorteil angeheizt.“ Die größte Schuldzuweisung aber betreibt die AfD selbst, ja sie scheint überhaupt fast nur aus Schuldzuweisung zu bestehen.
Die Gesellschaft steht vor immensen Herausforderungen. Es genügt, die Stichworte Klimawandel, Energiewende und Verteidigung zu nennen. Es wird Einschränkungen geben und gibt sie schon. So manche müssten freiwillig auf sich genommen werden, um künftig Schlimmeres für alle zu verhindern oder einzudämmen. Manche Einschränkungen werden verordnet werden müssen, weil nicht immer Einsicht obwaltet. Wer da in politischer Verantwortung steht, ist nicht beliebt. Aber er oder sie ist nicht daran schuld.
Wer ist schuld daran, dass die AfD so hohe Wahlergebnisse hat? Allein die, die sie gewählt haben. Sie werden verantworten müssen, was politisch daraus folgt.