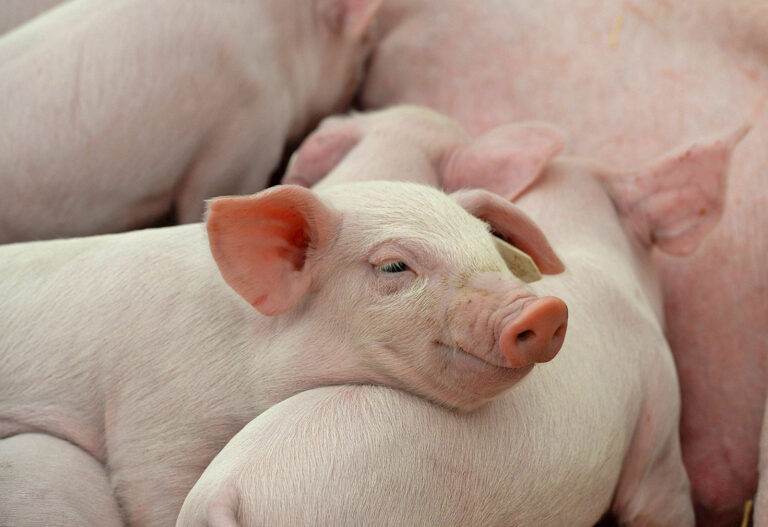Wie innovative Technik mithilfe gezielter Förderung in die Praxis gelangen kann, erfuhren die knapp 1.000 Besucher beim VR-Landwirtschaftstag, der am Montag in Neumünster stattfand.
„Wir fördern Hightech-Projekte im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft“, berichtete die Landwirtschaftsministerin Schleswig-Holsteins, Cornelia Schmachtenberg (CDU). Wissenstransfer und Vernetzung seien hier im Fokus. Mit Blick auf die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) kritisierte sie das bislang vorgesehene Budget als zu niedrig. Da die EU-Kommission bereits im Rahmen der Mercosur-Verhandlungen zu Zugeständnissen bereit gewesen sei, vermutet sie weiteren finanziellen Spielraum, den es auszureizen gelte. Auch bei der geplanten Förderstruktur müsse nachgebessert werden. Wenn die Nationalstaaten große Freiheiten bekämen und eigene Förderschwerpunkte festlegten, steige das Risiko für Wettbewerbsverzerrungen, mahnte Schmachtenberg. Kappung und Degression lehne die Kieler Landesregierung ab. Potenzial für bürokratische Entlastungen sieht die Ministerin vor allem im Datenmanagement.
Kritik an Verschiebepolitik
Auch Klaus-Peter Lucht, Präsident des Bauernverbandes Schleswig-Holstein (BVSH), fordert eine GAP, die fairen Wettbewerb unterstützt. Hinsichtlich der Förderung von Naturschutzmaßnahmen stellte er klar: „Wir müssen damit Geld verdienen können.“ Ein Kostenausgleich sei nicht ausreichend. Lucht mahnte zudem, die Ernährungssouveränität nicht außer Acht zu lassen. „Wenn wir es nicht schaffen, unsere Bevölkerung in Europa vernünftig zu ernähren, kann es zu sozialen Verwerfungen kommen“, warnte er. In diesem Zusammenhang fordert er schnellere Zulassungsverfahren für neue Pflanzenschutzmittelwirkstoffe. Seit 2019 sei nicht ein einziger neuer Wirkstoff zugelassen worden – in England hingegen vier. Grundsätzlich gebe es zu viel „Verschiebepolitik“. Als Beispiele nannte er die EU-Entwaldungsverordnung und das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz (THKG). Wenn die Förderung für Stallumbauten gestrichen werde, könne das THKG auch ganz weg, so Lucht.
Felix Lutz von der Generaldirektion Landwirtschaft der EU-Kommission verteidigte die GAP-Vorschläge. Er räumte aber ein: „Eine gewisse Renationalisierung kann man nicht abstreiten.“ Man wolle den Mitgliedstaaten Spielräume geben, um auf die Gegebenheiten vor Ort einzugehen. Mit Blick auf Kappung und Degression erklärte er: „Die Kassen sind knapper.“ Durch eine Analyse sei die Kommission zu dem Schluss gekommen, dass Großbetriebe weniger auf Zahlungen aus Brüssel angewiesen seien.
Bürokratie bremst
Ruben Soth, Digitalisierungsexperte bei der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, berichtete von bürokratischen Hindernissen bei der Etablierung von Agrardrohnen in der Praxis. Genehmigungsprozesse dauerten ein Jahr und länger. Das reduziere den Mehrwert. Grundsätzlich sei Hightech auf den meisten Betrieben bereits Realität. Soth schilderte: „Wir wissen vor den Pflanzen, dass sie Nährstoffmangel haben, und vor der Kuh, dass sie Fieber bekommt.“
Landwirt Carsten Stegelmann sieht in moderner Technik in Kombination mit Künstlicher Intelligenz (KI) Potenzial, Betriebsmittel einzusparen. Er betonte: „Obwohl der Green Deal gerade nicht das oberste Thema ist, beschäftigen wir Landwirte uns trotzdem intensiv damit.“ Moderne Maschinen sollten aus seiner Sicht deutlich selbsterklärender sein. Es koste oft viel Zeit, „bis man in einem System drin ist und es effizient nutzen kann“. Alke Hedemann von John Deere bestätigte diesen Eindruck. Sie berichtete: „Bei Vorführungen müssen wir eine Menge erklären, möglichst schnell und möglichst einfach.“
Thorsten Eichert, Geschäftsführer des Drohnen-Dienstleisters Drone Safty, machte Hoffnung: „Die Vernetzung von Maschinen untereinander wird besser.“ Mit Drohnen erstellte Applikationskarten ließen sich gut auf andere Maschinen übertragen.
Prof. Martin Braatz, Dekan des Fachbereichs Agrarwirtschaft der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Kiel (HAW), berichtete: „Digitalisierung und digitales Datenmanagement sind in der Lehre an der HAW eingezogen.“ Neue Technologien würden immer komplexer, deswegen gehörten regelmäßige Fortbildungen auf den Maschinen dazu.
Christopher Braun, Abteilungsleiter Agrarwirtschaft der DZ Bank, informierte, dass es je nach Förderschwerpunkt große Unterschiede bei den Kreditkonditionen gebe, und riet den Landwirten, sich vor Investitionsentscheidungen intensiv beraten zu lassen.
Stefan Lohmeier, Sprecher der Volksbanken Raiffeisenbanken (VR), betonte: „Technik bewegt viel, aber was Landwirtschaft wirklich ausmacht, sind die Menschen.“ Er sehe große Innovationskraft auf den Betrieben. Das wolle man honorieren und habe deswegen in diesem Jahr wieder den VR-Landwirtschaftspreis ausgelobt. Bewerbungsfrist ist der 15. Februar.