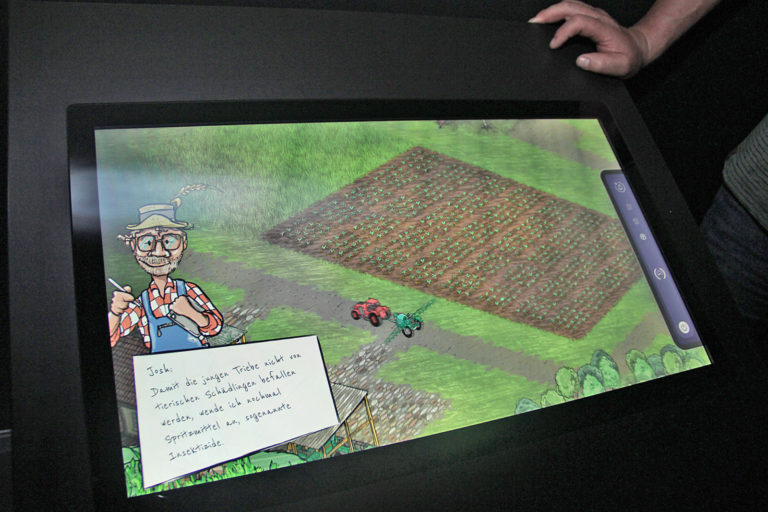Eine Frau und ein Mann gehen zum Arzt, weil es ihnen nicht gut geht. Beide haben einen Herzinfarkt. Der Mann wird, weil er die typischen Symptome gezeigt hat, sofort und richtig behandelt, die Frau wieder nach Hause geschickt. Ein typischer Fall, denn Frauen nehmen Erkrankungen anders wahr als Männer. Mit genau diesem Thema befasst sich die neue Gesundheitsaktion „Gesund trotz Frau – das weibliche Gesundheitsrisiko“, die der LandFrauenverband Schleswig-Holstein gemeinsam mit der Ärztekammer Schleswig-Holstein anbietet.
Die Daseinsfürsorge im ländlichen Raum sei ein besonderes Anliegen des LandFrauenverbandes, betonte Präsidentin Claudia Jürgensen zum Auftakt der Kampagne. Dass der Verband mit gut 28.000 Mitgliedern in 160 Ortsvereinen ein beliebter Partner der Ärztekammer ist, komme nicht von ungefähr. „Die Kammer feiert die LandFrauen, weil sie große Multiplikatorinnen sind“, so Jürgensen. Das hätten auch die vorangegangenen Aktionen zu Themen wie Telemedizin und dem Hören bewiesen. In den kommenden zwei Jahren soll es nun um die Frauengesundheit gehen.
Die Vizepräsidentin der Ärztekammer Schleswig-Holstein und LandFrau aus Husby, Dr. med. Gisa Andresen, schilderte zum Auftakt der Aktion auf dem LandFrauentag in Neumünster die aktuelle Situation. Demnach landeten Frauen in der Regel später in der Notaufnahme, im Herzkatheterlabor oder auf dem OP-Tisch, und das könne gefährlich werden. Frauen hätten zwar seltener einen Herzinfarkt, würden aber, relativ betrachtet, häufiger daran sterben. Und die Medizinerin nannte noch weitere alarmierende Fakten. Frauen erhielten seltener ein transplantiertes Herz, aber sie spendeten häufiger eines. Außerdem würden ihnen zum einen häufig zu hoch dosierte Medikamente und zum anderen Psychopharmaka als angebrachte Schmerzmedikationen verordnet.
Die Oberärztin der Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie des Diakonissenkrankenhauses Flensburg betonte aber zugleich, dass das keine Diskriminierung und auf keinen Fall so gewollt sei. Der Grund dafür liege darin, dass die Frauen in der medizinischen Forschung kaum vorkämen. So seien gesundheitliche Zusammenhänge noch nicht komplett verstanden und das führe zu Fehldiagnosen oder zu Therapieverzögerungen.
LandFrauenverband und Ärztekammer stellen bei der neuen Gesundheitsaktion aber nicht nur die sogenannte Gender-Problematik in den Mittelpunkt. „Es geht uns darum, mit Frauen über Gesundheit ins Gespräch zu kommen. Wir möchten aufklären: über Symptome, die sofort zum Arzt führen sollten, über sinnvolle Vorsorgeuntersuchungen und Selbstfürsorge. Und wir wollen die Frauen bestärken, ihrem Arzt und ihrer Ärztin selbstbewusst entgegenzutreten“, kündigte Andresen an.
Ab Herbst sollen die ersten Termine vor Ort angeboten werden. Das Bauernblatt wird darüber informieren.