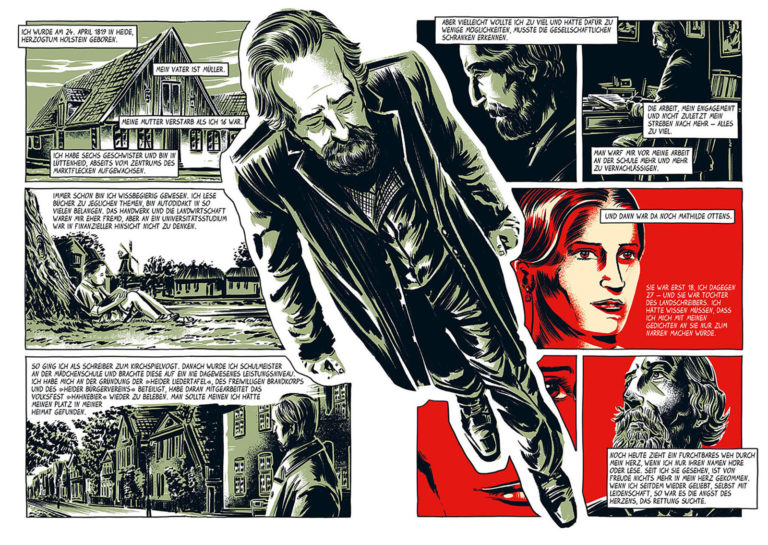Wirtschaftswachstum ist das Rezept für steigenden Wohlstand. Das weiß auch Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck (Grüne). Dabei ist wirtschaftliches Wachstum ein junges Konzept. Über Jahrtausende stagnierte der Wohlstand. Noch 1820 lebten mehr als 80 % der Weltbevölkerung in Armut. Seither nahm der Wohlstand weit schneller zu als die Weltbevölkerung. Ein Mensch ist heute 4,4-mal reicher als 1950. Ohne Wirtschaftswachstum, aber mit Bevölkerungswachstum wären wir dreimal ärmer. Im Durchschnitt ist der Mensch heute so reich wie 1950 „John Doe“, der Max Mustermann der USA, des damals wohlhabendsten Landes der Welt. Nur ist das Einkommen bekanntermaßen nicht gleich verteilt.
Freie Märkte und ein verlässlicher Rechtsstaat sind echte Wachstumsbooster. „Mister Wirtschaftswunder“ Ludwig Erhard (CDU) gab mit der Einführung der D-Mark im Jahr 1948 die Preise frei. „Im Grunde genommen hat niemand so recht an die Möglichkeit einer freien Lebensordnung oder sozialen Marktwirtschaft gedacht“, sagte der spätere erste Wirtschaftsminister der Bundesrepublik im Rückblick. Und zunächst schien das tatsächlich der falsche Weg zu sein. Die Regale füllten sich zwar über Nacht, aber die Preise stiegen so stark, dass sich die Menschen die Produkte kaum leisten konnten. Die Gewerkschaften riefen zum Generalstreik auf. Anfang der 1950er Jahre setzte dann das deutsche Wirtschaftswunder ein.
Was war Erhards Rezept? Der Staat sollte sich aus dem wirtschaftlichen Wettbewerb heraushalten, stattdessen die Rahmenbedingungen liefern. Auch hat der Staat Fürsorge für Menschen zu tragen, die nicht am wirtschaftlichen Handeln teilnehmen können. Erhards Motto: soziale Marktwirtschaft – so wenig Staat wie möglich, so viel Soziales wie nötig. Was für ein Konzept im Vergleich zu heutigen Lösungsvorschlägen!
Man mag es nicht glauben, aber Erhard lehnte Wirtschaftswachstum als politisches Ziel ab: „Mit steigender Produktivität und mit der höheren Effizienz der menschlichen Arbeit werden wir einmal in eine Phase der Entwicklung kommen, in der wir uns fragen müssen, was denn eigentlich kostbarer oder wertvoller ist: noch mehr zu arbeiten oder ein bequemeres, schöneres und freieres Leben zu führen, dabei vielleicht bewusst auf manchen güterwirtschaftlichen Genuss verzichten zu wollen.“
Die Marktwirtschaft verträgt eine Stagnation problemlos. Wachstum gibt es, weil der Mensch wachsende Bedürfnisse hat. Wer vom „Wohlstand für alle“ träumt, braucht Wachstum. Dieses Wachstum allerdings braucht als Basis die Entscheidungs- und Handlungsfreiheit des Einzelnen innerhalb einer festen Rechtssetzung.
Die Versuchung, wirtschaftliches Wachstum durch politisches Wuchern zu ersetzen, war schon immer groß. Erhards Nachfolger als Wirtschaftsminister, Karl Schiller (SPD), schuf 1967 das Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft. Seither muss der Staat für Wirtschaftswachstum sorgen – auch durch Staatsverschuldung.
Der Anteil der öffentlichen Schulden am Bruttosozialprodukt stieg seither sprunghaft an. Als das Wachstum schwächelte, die Arbeitslosenzahlen und die Verschuldung aber weiterstiegen, führte das nicht zu einer Korrektur, sondern in weitere Verschuldung. Spätestens seit der Jahrtausendwende ist klar, dass Schulden kein nachhaltiges Wachstum erzeugen. Seither wird die Geldpolitik auf Kosten des Geldwerts instrumentalisiert. Auch das kommt inzwischen an ein Ende. Was nun?
Vielleicht wäre eine Erhard‘sche Zeitenwende angebracht: Statt in staatlich produziertes Wuchern mit ungewisser Zukunftsprognose investieren wir Vertrauen in die Kreativität und den freien Wirtschaftswillen der Menschen. Das kostet nichts außer der Überwindung des politischen Mantras, dass der Staat alles besser kann. Vielleicht wächst die Politik ja mit den Herausforderungen.