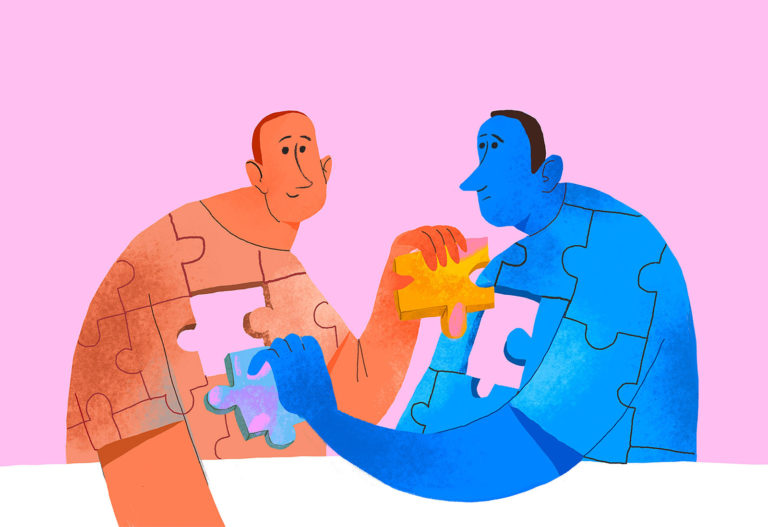In welchen Landwirtschaftssektoren derzeit investiert wird und wie sich die Bedeutung von Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Kreditvergabe entwickelt, beschreibt Stefan Lohmeier, Sprecher der Volksbanken Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein, im Interview mit dem Bauernblatt.
Aus Ihrem Geschäftsbericht zum Jahr 2024 geht hervor, dass die Investitionsbereitschaft der Landwirtschaft in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr gestiegen ist. Worauf führen Sie das zurück?
Als Nachfragetreiber für Kredite ist die Milchbranche zu nennen. Dort herrscht eine hohe Investitionsbereitschaft. Tatsächlich werden hier unter anderem klassische Stallbauprojekte angepackt. Im Schweinebereich erleben wir hingegen, dass viele Betriebe abwarten. Momentan fehlen planbare Rahmenbedingungen. Im südlichen Kreis Stormarn, wo ein Teil der Bank, die ich vertreten darf, schwerpunktmäßig unterwegs ist, kann ich mich kaum daran erinnern, wann wir zuletzt einen Schweinestall finanziert haben. Wenn wir dann noch auf den klassischen Ackerbaubereich schauen, stellen wir fest, dass in überschaubarem Maße Flächenzukäufe stattfinden, sofern sich Gelegenheiten bieten, aus Pachtflächen Eigentumsflächen zu machen.
Wie steht es um Investitionen in Technik?
Im Bereich der Landtechnik stellen wir eine Investitionszurückhaltung fest. Wir haben in den vergangenen Jahren den Einfluss der sogenannten Bauernmilliarde gespürt. Die Fördermittel sind in dieser Zeit für Investitionen genutzt worden. Aktuell investieren noch Milchviehbetriebe zum Beispiel in Melkroboter. Hier findet ein Tausch statt: Arbeitskraft gegen Technik.
Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei Investitionen?
Bei größeren Investitionen spielt Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Häufig geht es darum, den Netto-CO2-Ausstoß herunterzufahren und dadurch als Lieferant für die aufnehmende Hand – also Meiereigenossenschaften oder privaten Milchhandel – attraktiv zu sein. Die Meiereien achten zunehmend auf ihren CO2-Fußabdruck. Aus unserer Sicht als Bank hat das auch etwas mit dem Thema Risikomanagement zu tun. Es ist eine große Unbekannte, wie sich der CO2-Preis in Zukunft liquiditätsmäßig auf den Betrieben niederschlägt. Das ist eine Kostenkomponente, die es mit Blick auf das Risikomanagement zu kalkulieren gilt. Im Sinne der Nachhaltigkeit müssen zwar Ökonomie, Ökologie und Soziales im Einklang sein. Wir als Banken gucken aber natürlich sehr stark darauf, dass die Ökonomie funktioniert.
Woraus ergibt sich die Risikobewertung für Investitionen in der Landwirtschaft?
Eine landwirtschaftliche Besonderheit ist, dass ein Großteil der CO2-Emissionen rein aus dem Geschäftsmodell entsteht und teils unvermeidbar ist. Die Kuh muss Methan emittieren, um Milch zu produzieren. Daher gibt es noch keine Taxonomieerklärung für die Landwirtschaft. Momentan wird das aus Brüssel auch nicht intensiv weiterverfolgt. Trotzdem sind wir alle sehr aufmerksam, wie der Green Deal in Europa weiter umgesetzt wird. Wir haben bereits vor eineinhalb Jahren zwei Pilotbetriebe mithilfe eines Nachhaltigkeits-Tools analysieren lassen und uns mit einem Kreis von Landwirten dazu ausgetauscht. Ich nehme unter den Praktikern eine große Offenheit für das Thema wahr und ein Interesse, mit kleinen Maßnahmen, beispielsweise im Flächenmanagement, auch Einfluss auf Nachhaltigkeitswerte zu nehmen. Momentan haben alle Banken ihre eigenen Tools im Einsatz. Wir lernen also noch und sammeln vor allem Daten.
Für nachhaltige Energieerzeugung sind Erneuerbare Energien notwendig. Wie entwickelt sich dieser Bereich in Schleswig-Holstein?
An der gesamten Westküste von Nordfriesland bis nach Dithmarschen sowie an der Ostküste ist Windenergie weiter ein ganz großes Thema. Hier gibt es hohe Investitionen. Moderne Windkraftanlagen können schnell 5 bis 7 Mio. € pro Stück kosten. In früheren Jahren waren es stärker die Biogasanlagen, die das Segment Energie geprägt haben. Aktuell sind es Windkraftanlagen und Photovoltaik-Freiflächenanlagen.
Wie intensiv beobachten Sie den Strommarkt, um Investitionen in Biogasanlagen zu bewerten?
Die Bundesnetzagentur verlangt eine Flexibilisierung der Energiebereitstellung durch Überbauung der Biogasanlagen. Deswegen gilt aus unserer Sicht die Aufforderung an alle Biogasanlagenbetreiber, sich intensiv mit den Mechanismen auseinanderzusetzen und die eigene Risikotragfähigkeit zu erarbeiten, um das auch im Bankgespräch zu transportieren. Natürlich stehen wir als Volks- und Raiffeisenbanken bereit, auch mit der Expertise unserer DZ Bank. Es kommt immer auf die betriebsspezifischen Gegebenheiten an, beispielsweise darauf, ob ein Wärmenetz zur Verfügung steht.
In Ihrem Geschäftsbericht steht, dass Sie zwar vereinzelt Filialen geschlossen, zugleich aber mehr Mitarbeiter eingestellt haben. Woran liegt das?
Unsere Geschäfte wachsen, und wenn wir wachsen, brauchen wir mehr Menschen, die das Geschäft händeln. Auch das Thema Teilzeit hat einen höheren Stellenwert, sodass die reine Mitarbeiterzahl nicht mit früheren Jahren zu vergleichen ist. Darüber hinaus investieren wir gezwungenermaßen in interne Bereiche, weil die Bankenregulatorik zunimmt. Im Jahr 2004 hatten wir noch 500 beschriebene Seiten Bankregulatorik, heute sind es 55.000 Seiten.
Welche Forderung stellen Sie vor diesem Hintergrund an die neue Bundesregierung?
Das Thema Bürokratieabbau ist für alle Branchen wichtig, auch für uns Banken. Die Volksbanken und Raiffeisenbanken sind Verfechter eines sogenannten Proportionalitätsprinzips. Das heißt: Kleinere Institute sollten mit weniger Regularien belegt werden, auch um der Fusionsdynamik etwas entgegenzuhalten. Persönlich bin ich zuversichtlich, dass uns der Trend der Künstlichen Intelligenz in Zukunft helfen wird, die Prozesse aufzufangen und die Kosten intern überschaubar zu halten.
Warum sind die Volksbanken Raiffeisenbanken aus Ihrer Sicht für die Landwirte weiterhin ein guter Partner?
Unser Hauptsatz ist: Mache die Geschäfte mit den Menschen, die du kennst. Und wir kennen unsere Landwirtinnen und Landwirte und machen die Geschäfte sehr gern, um die Zukunftsinvestitionen für die Familienbetriebe oder auch die größeren Betriebe zu begleiten. Die genossenschaftliche Idee ist anpassungsfähig und letztendlich unsere Stärke. Unsere Eigentümer sind unsere Kunden. Wir haben viele Tausend Mitglieder in Schleswig-Holstein. Unser Geschäftsmodell ist darauf ausgelegt, unsere wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten, ohne dabei Maximalgewinne anzustreben, da dies nicht nachhaltig wäre. Das macht uns resilient und deswegen bin ich zuversichtlich, dass Genossenschaften eine der effektvollsten Rechtsformen sind, um auch in Zukunft erfolgreich im Bankgeschäft zu bestehen.